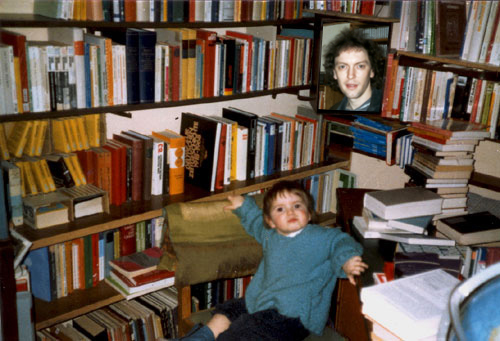Was Menschen von Anfang an sphärisch umgab, nennen wir den Immunschutz oder das Immunsystem, denn ein jedes menschliche Individuum ist von Anfang an von einer Hülle umgeben und wird in eine Gemeinschaft hineinsozialisiert. So ist der Mensch quasi von einer ersten natürlichen und einer zweiten kulturellen Hülle umgeben. Seine Identität erhält der Mensch durch die zweite Hülle, die wie eine zweite Haut wirkt. Dieses Immunsystem dient der Verteidigung seiner Integrität, und im Falle einer Verletzung dieser Immunsphäre reagiert der Mensch im allgemeinen allergisch und ergreift Verteidigungsmaßnahmen. Befindet sich der Mensch in einem für sein Immunsystem unverträglichen Milieu, kommt es zu Abstoßungsreaktionen. Man kann also sagen, daß viele Beziehungen zwischen Menschen an der Unverträglichkeit ihrer Immunsysteme scheitern. Im umgekehrten Fall gibt es aber auch eine Immunverträglichkeit, die aus einem unbewußten Drang zu Wahlverwandtschaften führt. Für ihre Identität sind Menschen im allgemeinen bereit, bis aufs Blut zu kämpfen, und eine Gefährdung kann nicht nur zu körperlichen, sondern auch zu seelischen und geistigen Schäden führen. Gäbe es kein Immunsystem, könnte sich das Leben weder im Ei und im Uterus noch in anderen Geborgenheiten und Schutzeinrichtungen entwickeln. Der erste Aufenthalt des Menschen ist der Uterus; hierin wird er zum Menschen; hier empfängt er alle Impulse, die er für das Leben braucht; hier erfährt er auch als einzigen Ort, wie es ist, rundum zufrieden zu sein. Die Uterodizee ist die Verteidigung der weiblichen Unterleibe, die auch Schöße genannt werden. Wer sich hier aufhält und zufrieden sein kann, geliebt wird, hat gute Chancen, auch nach dem Verlassen dieser Bleibe, des Gewohnt-Seins, zufrieden zu sein, geliebt zu werden. Im Uterus wird die Urform des Wohnens gelebt - nicht zufällig zeigt sich das auch an der Geschichte des Wortes Wohnen: Althochdeutsch wonen, „sich aufhalten“, „bleiben“, „gewohnt sein“ mit der Grundbedeutung „zufrieden sein“, abgeleitet aus dem Germanischen *wun, wurzelnd im Indogermanischen *uen, „verlangen“, „lieben“!
Wenn wir also
vom Wohnen-in-Hüllen sprechen, dann ist damit gemeint, daß alle und
jede Existenz nicht ohne Hülle gedacht werden kann - ganz im Sinne des phyiskalisch-chemischen
Weltbildes. Der Mensch beginnt wie alle Lebenwesen als physikalisch-chemisch eingehülltes
Wesen, das erst dann Lebewesen genannt werden darf, wenn es biologisch eingehüllt
ist. Wenn aber ein Lebewesen biologisch eingehüllt ist, ist es bald auch
ökologisch verortet, bald auch Teil eines ökonomischen oder soziologischen
Systems. Alles, was mit dem Wortstamm *oik (Ök) assoziiert werden
kann, hat immer mit Wohnen zu tun - ob wir die Errichtung, Gründung, Verwaltung,
Einrichtung, Aneignung u.s.w. einer Heimat oder mit ihren unterschiedlichen Formen
meinen: es geht immer um das Wohnen. Schon allein die physikalisch-chemische Existenz
ist als „Sein“ ( )
im Universum ein „In-Sein“ (
)
im Universum ein „In-Sein“ ( ),
„Im-Raum-Sein“ (
),
„Im-Raum-Sein“ ( ),
„In-der-Sphäre-Sein“; das biologische Wohnen ist ein Wohnen im
Ei, im Uterus, in der Familie, in der Gruppe u.s.w.; das ökologische Wohnen
ist ein Wohnen in der Nische, auf der Insel, in der Umwelt, in der Welt u.s.w.
(
),
„In-der-Sphäre-Sein“; das biologische Wohnen ist ein Wohnen im
Ei, im Uterus, in der Familie, in der Gruppe u.s.w.; das ökologische Wohnen
ist ein Wohnen in der Nische, auf der Insel, in der Umwelt, in der Welt u.s.w.
( ):
Hüllen sind, auch wenn wir sie Höhlen (
):
Hüllen sind, auch wenn wir sie Höhlen ( )
oder Hütten (
)
oder Hütten ( )
oder Häuser (
)
oder Häuser ( )
nennen, die ursprünglichen Wohnungen aller und jeder Existenz. Da also jede
Wohnung immer auf ihre Urform zurückgeht, ist jede Wohnung immer eine Hülle.
Allgemein kann niemand aus der Hülle ausbrechen, andererseits - und das heißt
hier speziell - wird gerade der Mensch dies auch weiterhin versuchen, ohne zu
merken, daß er sich immer nur neue Formen seiner Hülle sucht und daß
er, sobald er sie gefunden hat, doch immer der Kern seiner alten Hülle bleibt.
)
nennen, die ursprünglichen Wohnungen aller und jeder Existenz. Da also jede
Wohnung immer auf ihre Urform zurückgeht, ist jede Wohnung immer eine Hülle.
Allgemein kann niemand aus der Hülle ausbrechen, andererseits - und das heißt
hier speziell - wird gerade der Mensch dies auch weiterhin versuchen, ohne zu
merken, daß er sich immer nur neue Formen seiner Hülle sucht und daß
er, sobald er sie gefunden hat, doch immer der Kern seiner alten Hülle bleibt.
Wenn
wir unter Interaktionismus verstehen, daß zum Aufbau der Interaktion immer
eine der wichtigsten Voraussetzungen gehört, nämlich ein „Im-Raum-Sein“,
ein „In-Sein“ (Vom Wohnen-in-Hüllen bis zum Wohnen-in-Höhlen
war ein weiter, ähnlicher Weg zurückzulegen wie der, den das Kind vom
Sein-im-Uterus zum Sein-in-der-Familie bewältigen muß - jedoch dauerte
der Weg der Urmenschen bekanntlich viel länger. ( ).
Das sogenannte Paläolithikum (
).
Das sogenannte Paläolithikum ( )
umfaßt Altpaläolithikum, Mittelpaläolithikum und Jungpaläolithikum,
doch bereits gegen Ende des Altpaläolitikums und ganz sicher seit Beginn
des Mittelpaläolithikums lebten die meisten Menschen bereits in Hütten
(
)
umfaßt Altpaläolithikum, Mittelpaläolithikum und Jungpaläolithikum,
doch bereits gegen Ende des Altpaläolitikums und ganz sicher seit Beginn
des Mittelpaläolithikums lebten die meisten Menschen bereits in Hütten
( );
den Menschen des Jungpaläolitikums dienten die Höhlen, besonders die
tieferen Höhlenpartien, als Kult- und Initiationsplätze, bei deren Ritualen
auch Felsbilder entstanden. Im allgemeinen aber scheint der „Vulva-Zauber“
so alt zu sein wie das Altpalälithikum, so Sloterdijk: „Tatsächlich
sind von den altststeinzeitlichen Höhlenkulturen an Tendenzen zu einem Zwei-Wege-Verkehr
vor der weiblichen Öffnung, und durch sie, zu erkennen.“ (
);
den Menschen des Jungpaläolitikums dienten die Höhlen, besonders die
tieferen Höhlenpartien, als Kult- und Initiationsplätze, bei deren Ritualen
auch Felsbilder entstanden. Im allgemeinen aber scheint der „Vulva-Zauber“
so alt zu sein wie das Altpalälithikum, so Sloterdijk: „Tatsächlich
sind von den altststeinzeitlichen Höhlenkulturen an Tendenzen zu einem Zwei-Wege-Verkehr
vor der weiblichen Öffnung, und durch sie, zu erkennen.“ ( ).
Die Dreigleiderung für das Paläolithikum - Altpaläolithikum-Mittelpaläolithikum-Jungpaläolithikum
- verrät uns, wie schon die Dreigliederung der Steinzeit überhaupt (Paläolithikum-Mesolithikum-Neolithikum),
daß sie sich nicht nach Wohnräumen, sondern nach Steinen richtet, also
für unser Thema (Wohnen
).
Die Dreigleiderung für das Paläolithikum - Altpaläolithikum-Mittelpaläolithikum-Jungpaläolithikum
- verrät uns, wie schon die Dreigliederung der Steinzeit überhaupt (Paläolithikum-Mesolithikum-Neolithikum),
daß sie sich nicht nach Wohnräumen, sondern nach Steinen richtet, also
für unser Thema (Wohnen )
eigentlich gar nicht so gut geeignet ist. Trotzdem behalten wir sie bei, weil
die Steine im Rückblick eine gesichertere Erkenntnis erlauben als
die Wohnungen; andererseits geben uns die Wohnungen den intensiveren Eindruck
über das „Zusammen-Sein“, über Luxus bzw. Komfort, ja letztendlich
über Immunität bzw. Immunschutz, denn davon können die Steine nur
indirekt erzählen. Je älter jedoch die Wohungseinrichtungen sind,
desto geringer sind die späteren handfesten Beweise, so könnte eine
wissenschaftliche Regel lauten; je geringer die späteren handfesten Beweise
sind, desto älter sind die Wissenschaftsurteile, so könnte eine philosophische
Regel lauten.
)
eigentlich gar nicht so gut geeignet ist. Trotzdem behalten wir sie bei, weil
die Steine im Rückblick eine gesichertere Erkenntnis erlauben als
die Wohnungen; andererseits geben uns die Wohnungen den intensiveren Eindruck
über das „Zusammen-Sein“, über Luxus bzw. Komfort, ja letztendlich
über Immunität bzw. Immunschutz, denn davon können die Steine nur
indirekt erzählen. Je älter jedoch die Wohungseinrichtungen sind,
desto geringer sind die späteren handfesten Beweise, so könnte eine
wissenschaftliche Regel lauten; je geringer die späteren handfesten Beweise
sind, desto älter sind die Wissenschaftsurteile, so könnte eine philosophische
Regel lauten.
„Ein großer natürlicher Hohlraum im Gestein“
- so lautet die Definition für die Höhle, wie sie im Lexikon nachzulesen
ist (z.B. bei Meyer, Großes Taschenlexikon). Überall dort, wo
Menschen in Höhlen lebten, wurde nach und nach und mehr und mehr der „Fußboden“
mit Abfällen bedeckt, denn das „Aufräumen“ nahmen die Höhlenbewohner
nicht so genau; für unsere modernen Forscher waren und sind diese
angehäuften Abfälle regelrecht „ein gefundenes Fressen“, denn
zwischen den Besiedlungsphasen hatten sich natürliche Schichten aus Deckenschutt,
Höhlenlehm und eingewehtem Staub angesammelt, und über eine sehr lange
Zeit hinaus hatten sich die Abfallschichten quasi aufgetürmt, die Höhlenböden
waren enorm angestiegen: Wissenschaftler haben Höhlen mit - sage und schreibe
- 18 Meter hohen Natur-und-Kultur-Schichten entdeckt! Die meisten Zeugnisse der
gesamten Prähistorie sind nur unter dem Erdboden zu finden, und dort, wo
sie von der Natur nicht begraben worden sind, gibt es für die Prähistoriker
auch kaum etwas zu erforschen. Es gibt nur wenige Objekte, die ohne Schutz, z.B.
durch Erde und Wasser (bzw. Eis, Schnee u.s.w.), der Abtragung der Natur widerstehen
können und deswegen schutzlos der Vernichtung ausgesetzt sind, z.B. durch
Feuer und Luft (bzw. Sauerstoff, Wind u.s.w.). Aber gilt das auch z.B. für
die Höhlenkunst? Ja, zum Teil, aber sie ist eben noch kein Produkt
der Frühmenschen (vgl. Hominisierung ),
ja auch noch keines der Altmenschen namens Homo sapiens (vgl. Sapientisierung
),
ja auch noch keines der Altmenschen namens Homo sapiens (vgl. Sapientisierung ),
sondern erst eines der Jetztmenschen namens Homo sapiens sapiens
(vgl. Historisierung
),
sondern erst eines der Jetztmenschen namens Homo sapiens sapiens
(vgl. Historisierung ).
Die Höhlenkunst entwickelte sich erst, als die Höhlen kaum noch als
Wohnraum genutzt wurden, also im Jungpaläolithikum, und zwar aus primitiven
Anfängen heraus (Handabdrücke u.ä.) bis hin zur fast professionell
anmutenden Wandkunst, die wir als Felsbilder oder Höhlenmalerei kennen. Dies
hat mit Magie, mit Glauben, mit einer Ur-Religion bzw. mit einer Ur-Theologie
zu tun, und deshalb gab es diesen Zauberkult auch schon im Altpaläolithikum,
also zu einer Zeit, als die Höhlen zum Wohnraum wurden und es sehr lange
blieben, aber erst im Jungpaläolithikum dienten besonders die tieferen Höhlenpartien
als Kult- und Initiationsplätze, bei deren Ritualen die Felsbilder entstanden,
die wir heute Wandkunst oder Höhlenmalerei nennen.
).
Die Höhlenkunst entwickelte sich erst, als die Höhlen kaum noch als
Wohnraum genutzt wurden, also im Jungpaläolithikum, und zwar aus primitiven
Anfängen heraus (Handabdrücke u.ä.) bis hin zur fast professionell
anmutenden Wandkunst, die wir als Felsbilder oder Höhlenmalerei kennen. Dies
hat mit Magie, mit Glauben, mit einer Ur-Religion bzw. mit einer Ur-Theologie
zu tun, und deshalb gab es diesen Zauberkult auch schon im Altpaläolithikum,
also zu einer Zeit, als die Höhlen zum Wohnraum wurden und es sehr lange
blieben, aber erst im Jungpaläolithikum dienten besonders die tieferen Höhlenpartien
als Kult- und Initiationsplätze, bei deren Ritualen die Felsbilder entstanden,
die wir heute Wandkunst oder Höhlenmalerei nennen.
Höhlen
sind die Wohnungen der Frühmenschen (vgl. Hominisierung ),
sie unterscheiden sich von den vor-/urmenschlichen Hüllen (
),
sie unterscheiden sich von den vor-/urmenschlichen Hüllen ( )
durch die konkretere Form und vor allem durch den erweiterten Immunschutz: Frühmenschliche
Wohnungen legen Zeugnis ab davon, daß sich der Mensch auch wohnungstechnisch
von den anderen Mitgliedern der Überfamilie namens Hominoidea (
)
durch die konkretere Form und vor allem durch den erweiterten Immunschutz: Frühmenschliche
Wohnungen legen Zeugnis ab davon, daß sich der Mensch auch wohnungstechnisch
von den anderen Mitgliedern der Überfamilie namens Hominoidea ( )
getrennt hat, denn die Höhle ist ja keine Wohnung für Menschenaffen
oder Gibbons, wie man weiß. Seit dieser Zeit der Trennung von den anderen
Mitgliedern der Menschenartigen bauen Menschen keine „Nester“ mehr,
weder in den Bäumen noch auf dem Boden, und hüllen sich auch sonst nicht
mehr so ein, wie es ihre vor-/urmenschlichen Ahnen taten, und wie es ihre nächstverwandten
Familien, die Familie namens Pongidae (Menschenaffen) und die Familie namens Hylobatidae
(Gibbons) sogar heute noch tun. Den Stein benutzten schon die Vor-/Urmenschen
als Werkzeug (vgl. „Zeug“
)
getrennt hat, denn die Höhle ist ja keine Wohnung für Menschenaffen
oder Gibbons, wie man weiß. Seit dieser Zeit der Trennung von den anderen
Mitgliedern der Menschenartigen bauen Menschen keine „Nester“ mehr,
weder in den Bäumen noch auf dem Boden, und hüllen sich auch sonst nicht
mehr so ein, wie es ihre vor-/urmenschlichen Ahnen taten, und wie es ihre nächstverwandten
Familien, die Familie namens Pongidae (Menschenaffen) und die Familie namens Hylobatidae
(Gibbons) sogar heute noch tun. Den Stein benutzten schon die Vor-/Urmenschen
als Werkzeug (vgl. „Zeug“ );
er ist also als Unterscheidungskriterium von den - bekanntlich auch den Stein
benutzenden - nächstverwandten Familien nur bedingt geeignet. Der Gebrauch
der Sprache als Übertragungswerkzeug und Nähe-Dichtung, in
Über-Einstimmung mit dem Gebrauch des Feuers, ist jedoch
dazu bestens geeignet. (
);
er ist also als Unterscheidungskriterium von den - bekanntlich auch den Stein
benutzenden - nächstverwandten Familien nur bedingt geeignet. Der Gebrauch
der Sprache als Übertragungswerkzeug und Nähe-Dichtung, in
Über-Einstimmung mit dem Gebrauch des Feuers, ist jedoch
dazu bestens geeignet. ( ).
Das Kultur-Ursymbol (Stein, z.B. zuerst als Wurf-Zeug
).
Das Kultur-Ursymbol (Stein, z.B. zuerst als Wurf-Zeug )
konnte für Menschen erst durch den erfolgreichen und „weltoffenen“
Homo erectus erweitert werden zu einem ersten Kultursymbol (Feuer, z.B.
als Spender von Wärme und Licht, Komfort und Luxus, Nähe und Distanz,
Leben und Tod - eigentlich alles, was im Hinblick auf Nutzbarmachung unendlich
viele Folgen für den Menschen und seine Welt hatte, hat und haben
wird
)
konnte für Menschen erst durch den erfolgreichen und „weltoffenen“
Homo erectus erweitert werden zu einem ersten Kultursymbol (Feuer, z.B.
als Spender von Wärme und Licht, Komfort und Luxus, Nähe und Distanz,
Leben und Tod - eigentlich alles, was im Hinblick auf Nutzbarmachung unendlich
viele Folgen für den Menschen und seine Welt hatte, hat und haben
wird ).
Durch den Feuergebrauch, der wie der Sprachgebrauch die Kulturtechnik des Menschen
erst richtig deutlich erkennen läßt, wurde Homo erectus auch
zum entscheidenden Faktor in der sprachlichen Menschwerdung. Dieser „aufrechte
Mensch“ war wohl die einzige Menschenart, die 1,86 Millionen Jahre überlebte.
).
Durch den Feuergebrauch, der wie der Sprachgebrauch die Kulturtechnik des Menschen
erst richtig deutlich erkennen läßt, wurde Homo erectus auch
zum entscheidenden Faktor in der sprachlichen Menschwerdung. Dieser „aufrechte
Mensch“ war wohl die einzige Menschenart, die 1,86 Millionen Jahre überlebte.
 Hütten
Hütten
Raumlogisch unterscheiden sich die Hütten von ihren Vorgängern,
den Höhlen ( ),
durch eine geringere Ortsgebundenheit bzw. eine größere Freiheit
der Ortswahl, und von ihren Nachfolger, den Häusern (
),
durch eine geringere Ortsgebundenheit bzw. eine größere Freiheit
der Ortswahl, und von ihren Nachfolger, den Häusern ( ),
durch das Fehlen eines Saat-Ernte-Zusammenhangs, denn die Hütte hat
kein Ernteprojekt, das erst mit den Häusern beginnt. Alle Wohnungen
bauen aufeinander auf: das Phänomen der Hüllen (
),
durch das Fehlen eines Saat-Ernte-Zusammenhangs, denn die Hütte hat
kein Ernteprojekt, das erst mit den Häusern beginnt. Alle Wohnungen
bauen aufeinander auf: das Phänomen der Hüllen ( )
ist in Höhlen, in Hütten und in Häusern enthalten, das
heißt umgekehrt, daß Häuser phänomenologisch Hütten,
Höhlen und Hüllen, daß Hütten phänomenologisch
Höhlen und Hüllen, daß Höhlen phänomenologisch
Hüllen, daß also nur Hüllen phänomenologisch sich
selbst enthalten. Kann das Haus die Hütte enthalten, so kann umgekehrt
die Hütte nicht das Haus enthalten. In der Hütte geht es um
die „Bergung des Schlafs, den Wetter- und Ungezieferschutz, die Bereitstellung
einer Rückzugssphäre für Sexuelles und einer Komfortsphäre
für verdauungsträge Zustände.“ (
)
ist in Höhlen, in Hütten und in Häusern enthalten, das
heißt umgekehrt, daß Häuser phänomenologisch Hütten,
Höhlen und Hüllen, daß Hütten phänomenologisch
Höhlen und Hüllen, daß Höhlen phänomenologisch
Hüllen, daß also nur Hüllen phänomenologisch sich
selbst enthalten. Kann das Haus die Hütte enthalten, so kann umgekehrt
die Hütte nicht das Haus enthalten. In der Hütte geht es um
die „Bergung des Schlafs, den Wetter- und Ungezieferschutz, die Bereitstellung
einer Rückzugssphäre für Sexuelles und einer Komfortsphäre
für verdauungsträge Zustände.“ ( ).
Deswegen kann also das Haus die Hütte enthalten, aber umgekehrt „kann
die Hütte nie das Haus enthalten, weil sie kein Ernteprojekt hat
und sich im Obdachgeben von Tag zu Tag erschöpft.“ (
).
Deswegen kann also das Haus die Hütte enthalten, aber umgekehrt „kann
die Hütte nie das Haus enthalten, weil sie kein Ernteprojekt hat
und sich im Obdachgeben von Tag zu Tag erschöpft.“ ( ).
Die Hütte ist die erste von Menschen selbst gebaute Höhle aufgrund
der Hülle, also: der Funktion der Immunität. In allen Wohnungen
geht es immer um Immunschutz, weshalb sie immer auch Hüllen sind.
Zuerst bedeutet Wohungseinrichtung immer eine Einrichtung in dem, was
die Natur unmittelbar als Hülle (Nische. Insel u.s.w.) bereitstellt;
der zweite Schritt ist eine selektiv gewählte Hülle und stellt
immer auch eine Differenzierung von den Nächstverwandten dar; der
dritte Schritt ist die selbständig errichtete Hülle; der vierte
Schritt ist die selbständig errichtete und zum Zweck der Ernte selektiv
gewählte Hülle. Das Haus ist ohne das Ernteprojekt nicht zu
denken, woraus folgt, daß die erste Hütte vor der Seßhaftigkeit
(
).
Die Hütte ist die erste von Menschen selbst gebaute Höhle aufgrund
der Hülle, also: der Funktion der Immunität. In allen Wohnungen
geht es immer um Immunschutz, weshalb sie immer auch Hüllen sind.
Zuerst bedeutet Wohungseinrichtung immer eine Einrichtung in dem, was
die Natur unmittelbar als Hülle (Nische. Insel u.s.w.) bereitstellt;
der zweite Schritt ist eine selektiv gewählte Hülle und stellt
immer auch eine Differenzierung von den Nächstverwandten dar; der
dritte Schritt ist die selbständig errichtete Hülle; der vierte
Schritt ist die selbständig errichtete und zum Zweck der Ernte selektiv
gewählte Hülle. Das Haus ist ohne das Ernteprojekt nicht zu
denken, woraus folgt, daß die erste Hütte vor der Seßhaftigkeit
( )
entstanden, also von Nomaden gebaut worden sein muß. Aber wann genau
ist die erste Hütte entstanden?
)
entstanden, also von Nomaden gebaut worden sein muß. Aber wann genau
ist die erste Hütte entstanden?
Ein wissenschaftlich belegtes Beispiel:
In Bilzingsleben (Thüringen) fand man eine 300 000 bis 350 000 Jahre alte
Heimbasis für eine 50 Personen starke Homo-erectus-Gruppe, deren Lager
offenbar das Zentrum eines größeren Schweifgebietes von ungefähr
20 km Durchmesser war, das immer wieder im Wechsel mit ähnlichen Stellen
aufgesucht wurde. „Am Fundplatz Bilzingsleben stießen die Ausgräber
auf Grundrisse von zwei Hütten. Der eine davon war oval und vier mal drei
Meter groß, der andere rund mit einem Durchmesser von drei Metern. Die Grundrisse
waren durch große Steine und Knochen markiert. Vor den Hütten lagen
Reste einer Feuerstelle: bis zu einem Meter lange verkohlte Stämme, versinterte
Hölzer und brandrissige Steine. Rings um die Feuerstelle ließen sich
fünf Arbeitsplätze zur Bearbeitung von Knochen-, Holz- und Steinwerkzeugen
nachweisen - jeweils mit Werkstücken oder deren Abfällen und je einem
großen Amboß aus Muschelkalkplatten oder einem Schienbein vom Elefanten.
Unter den unzähligen Knochenfunden erregten drei Exemplare mit eingravierten
linearen Ornamenten das besondere Interesse der Wissenschaftler: - Ein 40 Zentimeter
langer Splitter vom Schienbein eines Elefanten, der als Gerät benutzt wurde,
weist an der flachen Längsseite mindestens 21 aufgefächerte Schnittlinien
in regelmäßigen Abständen auf. - Eine polierte Rippe trägt
parallele Schräglinien, die jeweils dreifach angesetzt wurden. - Ein Knochenplattenbruchstück
läßt Strichbündel erkennen. Die ersten Ritzungen .... Ihre Bedeutung
ist derzeit noch unklar. Womöglich handelt es sich um älteste Darstellungen
menschlicher Gedanken!“ (Ernst Probst, Deutschland in der Urzeit,
1986, S. 349 ).
Der Bilzingslebener Fund ist nach Ansicht seiner Bearbeiter eine der jüngsten
Homo-erectus-Formen, und als europäische Variante des Homo erectus
heißen sie seit 1974 Homo erectus bilzingslebenensis. Nach den fossilen
Pflanzenresten von Bilzingsleben zu urteilen, herrschte hier zu dieser Zeit ein
warmzeitliches Klima mit mediterranem Einfluß. Zum Bilzingslebener Fund
gehören auch insgesamt zweieinhalb Tonnen Speiseabfälle, die Einblicke
in die Eßgewohnheiten des Homo erectus bilzingslebenensis gestatten:
Wald- und Steppenelefant, Wald- und Steppennashorn, Bison, Wildpferd, Rothirsch,
Damhirsch, Reh, Biber, Bär, Wildschwein, Fuchs, Dachs, Wolf, Löwe, Wildkatze,
Affe u.a.; die Beutetiere lassen auf eine Tierwelt zur Zeit des Homo erectus
bilzingslebenensis schließen, die derjenigen eines hochwarmzeitlichen
Stadiums des Eiszeitalters entspricht. „Von den 90 bekannten Molluskenarten
aus Bilzingsleben gehören zahlreiche zu exotischen Arten. Unter den nachgewiesenen
Muschelkrebsen befindet sich eine Art, die heute subtropisch verbreitet ist.“
(Ernst Probst, ebd.
).
Der Bilzingslebener Fund ist nach Ansicht seiner Bearbeiter eine der jüngsten
Homo-erectus-Formen, und als europäische Variante des Homo erectus
heißen sie seit 1974 Homo erectus bilzingslebenensis. Nach den fossilen
Pflanzenresten von Bilzingsleben zu urteilen, herrschte hier zu dieser Zeit ein
warmzeitliches Klima mit mediterranem Einfluß. Zum Bilzingslebener Fund
gehören auch insgesamt zweieinhalb Tonnen Speiseabfälle, die Einblicke
in die Eßgewohnheiten des Homo erectus bilzingslebenensis gestatten:
Wald- und Steppenelefant, Wald- und Steppennashorn, Bison, Wildpferd, Rothirsch,
Damhirsch, Reh, Biber, Bär, Wildschwein, Fuchs, Dachs, Wolf, Löwe, Wildkatze,
Affe u.a.; die Beutetiere lassen auf eine Tierwelt zur Zeit des Homo erectus
bilzingslebenensis schließen, die derjenigen eines hochwarmzeitlichen
Stadiums des Eiszeitalters entspricht. „Von den 90 bekannten Molluskenarten
aus Bilzingsleben gehören zahlreiche zu exotischen Arten. Unter den nachgewiesenen
Muschelkrebsen befindet sich eine Art, die heute subtropisch verbreitet ist.“
(Ernst Probst, ebd. ).
Neben Schädeltieren und Zähnen fanden die Ausgräber etwa 20 000
Werkzeuge (vorzugsweise in einer Abschlagtechnik hergestellt), 80 000 Abfallstücke,
500 Geröllgeräte wie Hackmesserwerkzeuge, Ambosse etc. und eine erhebliche
Anzahl von Knochen-und Geweihgeräten, die aus Hirsch- oder Elefantenknochen
angefertigt waren, und zu dieser erheblichen Anzahl gehören auch die drei
eben erwähnten Exemplare, die besonderes Aufsehen erregten, weil sie (laut
Probst
).
Neben Schädeltieren und Zähnen fanden die Ausgräber etwa 20 000
Werkzeuge (vorzugsweise in einer Abschlagtechnik hergestellt), 80 000 Abfallstücke,
500 Geröllgeräte wie Hackmesserwerkzeuge, Ambosse etc. und eine erhebliche
Anzahl von Knochen-und Geweihgeräten, die aus Hirsch- oder Elefantenknochen
angefertigt waren, und zu dieser erheblichen Anzahl gehören auch die drei
eben erwähnten Exemplare, die besonderes Aufsehen erregten, weil sie (laut
Probst )
womöglich die ältesten Darstellungen menschlicher Gedanken sind.
)
womöglich die ältesten Darstellungen menschlicher Gedanken sind.
Im
Jungpaläolithikum, auch oberes Paläolithikum oder Spätpaläolithikum
genannt, begann der Mensch eine spezialisierte Jagd zu betreiben und sich auf
Mammut-, Wildpferd- oder Rentierjagd zu konzentrieren. Deshalb wurden auch die
Waffen technisch verbessert, besonders bemerkenswert sind die fein gearbeiteten
Speerspitzen. Einige Funde belegen sogar vereinzelt einen allmählichen Beginn
der Seßhaftigkeit ( ),
ein entwickeltes Gemeinschaftsleben und eine Züchtung von Wölfen. Der
Ahnenkult begann ebenfalls schon im Jungpaläolithikum, wenn auch als ein
nomadischer Prototyp des höheren Jägertums - vergleichbar mit dem heutigen
Ahnenkult der Hirtennomaden. Das Jungpaläolithikum stellt sozusagen den Einleitungszyklus
der neanthropinen Periode dar, weil hier der dominant werdende und danach einzig
übrig bleibende Familienvertreter Homo sapiens sapiens seine Einzelkarriere
begann, nachdem er der Homo sapiens neanderthalensis verdrängt hatte und
mit seiner Höhlenkunst sowie seinem Schmuckkult erste Kunstwerke schuf. Wer
Kunstwerke hinterläßt, der will sich und seiner Welt mitteilen, eine
Spur hinterlassen und (wie ein Kleinkind!) voller Stolz auch am nächsten
Tag noch sagen können: „Das bin ich gewesen“. Die Geschichte der
künstlerischen Selbstreferenz begann also in den Höhlen. (Vgl. Kunst
),
ein entwickeltes Gemeinschaftsleben und eine Züchtung von Wölfen. Der
Ahnenkult begann ebenfalls schon im Jungpaläolithikum, wenn auch als ein
nomadischer Prototyp des höheren Jägertums - vergleichbar mit dem heutigen
Ahnenkult der Hirtennomaden. Das Jungpaläolithikum stellt sozusagen den Einleitungszyklus
der neanthropinen Periode dar, weil hier der dominant werdende und danach einzig
übrig bleibende Familienvertreter Homo sapiens sapiens seine Einzelkarriere
begann, nachdem er der Homo sapiens neanderthalensis verdrängt hatte und
mit seiner Höhlenkunst sowie seinem Schmuckkult erste Kunstwerke schuf. Wer
Kunstwerke hinterläßt, der will sich und seiner Welt mitteilen, eine
Spur hinterlassen und (wie ein Kleinkind!) voller Stolz auch am nächsten
Tag noch sagen können: „Das bin ich gewesen“. Die Geschichte der
künstlerischen Selbstreferenz begann also in den Höhlen. (Vgl. Kunst ).
Gleichzeitig wurden ab jetzt die zuvor noch nicht von Menschen bewohnten Kontinente
besiedelt, so daß die Erde eine erste menschliche Voll-Besetzung
erlebte, die sich in dem Begriff Neue Welt als restglobaler Lebensraum
ausdrückt. Isolierungen und Nischen wurden für menschliche Insulaner
von nun an rar - vergleichsweise! Ab jetzt formten sich auch die heute bekannten
Großrassen: Europide, Negride, Mongolide und Australide. Bald darauf entstand
in Europa schon die Vor- bzw. Urkultur der Indogermanen. (
).
Gleichzeitig wurden ab jetzt die zuvor noch nicht von Menschen bewohnten Kontinente
besiedelt, so daß die Erde eine erste menschliche Voll-Besetzung
erlebte, die sich in dem Begriff Neue Welt als restglobaler Lebensraum
ausdrückt. Isolierungen und Nischen wurden für menschliche Insulaner
von nun an rar - vergleichsweise! Ab jetzt formten sich auch die heute bekannten
Großrassen: Europide, Negride, Mongolide und Australide. Bald darauf entstand
in Europa schon die Vor- bzw. Urkultur der Indogermanen. ( ).
Der erste Bergbau fiel ebenfalls in die Zeit des Jungpaläolithikums, und
diente insbesondere der Gewinnung von Feuerstein in offenen Gruben und in unterirdischen
Steinbrüchen (vor allem in Jura- und Kreidekalken). Zum Abbau wurden Werkzeuge
aus Hirschgeweihen oder Feuerstein benutzt; nachgewiesen sind auch erste Spuren
des Feuersetzens zur Lockerung des Gesteins. Die Indogermanen, die wohl Hirtennomaden
waren und deren Sprache rekonstruiert werden kann, besaßen offenbar kein
Wort für „Heimat“, weshalb sie schon vor der „Neolithische
Revolution“ (
).
Der erste Bergbau fiel ebenfalls in die Zeit des Jungpaläolithikums, und
diente insbesondere der Gewinnung von Feuerstein in offenen Gruben und in unterirdischen
Steinbrüchen (vor allem in Jura- und Kreidekalken). Zum Abbau wurden Werkzeuge
aus Hirschgeweihen oder Feuerstein benutzt; nachgewiesen sind auch erste Spuren
des Feuersetzens zur Lockerung des Gesteins. Die Indogermanen, die wohl Hirtennomaden
waren und deren Sprache rekonstruiert werden kann, besaßen offenbar kein
Wort für „Heimat“, weshalb sie schon vor der „Neolithische
Revolution“ ( )
existiert haben müssen - wahrscheinlich, wie gesagt, seit dem Jungpaläolithikum
als nicht-seßhafte Hirten, die den Ort je nach Zustand der Weide wechselten.
(
)
existiert haben müssen - wahrscheinlich, wie gesagt, seit dem Jungpaläolithikum
als nicht-seßhafte Hirten, die den Ort je nach Zustand der Weide wechselten.
( ).
Vielleicht begingen ja auch schon die Nicht-Seßhaften einen ritualisierten
Weg zurück in die Immunität der Hüllen (
).
Vielleicht begingen ja auch schon die Nicht-Seßhaften einen ritualisierten
Weg zurück in die Immunität der Hüllen ( ),
und zwar konkretisiert in den Höhlen (
),
und zwar konkretisiert in den Höhlen ( )
- die hinterlassene Kunst scheint dies zu bestätigen:
)
- die hinterlassene Kunst scheint dies zu bestätigen:
„Der
Vulva-Zauber hat seinen Grund in dem Elementargedanken, daß das Muttertor,
das von sich her als Ausgang dient, und nur als solcher, auch als Eingang in Anspruch
genommen werden muß - nicht so sehr in einem sexuell-erotischen, also partiellen
Akt, versteht sich, sondern in einem religiösen, existenzumgreifenden Sinn.
Tatsächlich sind von den altststeinzeitlichen Höhlenkulturen an Tendenzen
zu einem Zwei-Wege-Verkehr vor der weiblichen Öffnung, und durch sie, zu
erkennen.“ ( ).
Es gab also auch schon im Altpaläolithikum religiös motivierte Vulva-Interessen,
obwohl zu der Zeit die Höhlen (
).
Es gab also auch schon im Altpaläolithikum religiös motivierte Vulva-Interessen,
obwohl zu der Zeit die Höhlen ( )
noch Wohnraum waren, denn der Übergang von der Höhlenzeit in die Hüttenzeit
vollzog sich erst allmählich gegen Ende des Altpaläolithikums, vor allem
im Mittelpaläolithikum und war im Jungpaläolithikum bereits endgültig,
denn im Jungpaläolithikum dienten besonders die tieferen Höhlenpartien
als Kult- und Initiationsplätze, bei deren Ritualen auch Felsbilder entstanden.
Ein eindeutiges Indiz. Und es ist weiterhin sogar unleugbar, daß „es
eine präzise historische Konjunktur für erhöhte religiöse
Vulva-Interessen gegeben hat. Der Massenandrang vor der Passage ins weibliche
Innere läßt sich kulturgeschichtlich datieren: Es ist die berüchtigte
neolithische Revolution (
)
noch Wohnraum waren, denn der Übergang von der Höhlenzeit in die Hüttenzeit
vollzog sich erst allmählich gegen Ende des Altpaläolithikums, vor allem
im Mittelpaläolithikum und war im Jungpaläolithikum bereits endgültig,
denn im Jungpaläolithikum dienten besonders die tieferen Höhlenpartien
als Kult- und Initiationsplätze, bei deren Ritualen auch Felsbilder entstanden.
Ein eindeutiges Indiz. Und es ist weiterhin sogar unleugbar, daß „es
eine präzise historische Konjunktur für erhöhte religiöse
Vulva-Interessen gegeben hat. Der Massenandrang vor der Passage ins weibliche
Innere läßt sich kulturgeschichtlich datieren: Es ist die berüchtigte
neolithische Revolution ( ),
nach der die Schoß-Faszination erst zur Weltmacht sich entfalten konnte.
Im neolithischen Umbruch traten zuerst jene Verhältnisse hervor, durch die
der Territorialismus über die Menschheit kam; nun erst beginnen die bodenverwurzelten
Identitäten ihre Blüten zu treiben; jetzt erst müssen sich Menschen
durch ihren Ort ihre Bodenhaftungen und schließlich durch ihren Besitz identifizieren.“
(
),
nach der die Schoß-Faszination erst zur Weltmacht sich entfalten konnte.
Im neolithischen Umbruch traten zuerst jene Verhältnisse hervor, durch die
der Territorialismus über die Menschheit kam; nun erst beginnen die bodenverwurzelten
Identitäten ihre Blüten zu treiben; jetzt erst müssen sich Menschen
durch ihren Ort ihre Bodenhaftungen und schließlich durch ihren Besitz identifizieren.“
( ).
Mit anderen Worten: Die neusteinzeitliche Revolution lockte die bis dahin nomadisierenden
Menschengruppen in die Besitzfalle der Seßhaftigkeit:
).
Mit anderen Worten: Die neusteinzeitliche Revolution lockte die bis dahin nomadisierenden
Menschengruppen in die Besitzfalle der Seßhaftigkeit:
 Häuser
Häuser
Der Übergang von
den Umherziehend-Wohnenden, dem Nomadentum, zu den Seßhaft-Wohnenden,
dem Sedententum, vollzog sich durch die Explzitwerdung namens „Neolithische
Revolution“ ( ).
Zahlreiche kulturelle Innovationen stellten sich als Folge der Einführung
der produzierenden Wirtschaftsweise ein: sie erlaubte es dem Menschen seßhaft
zu werden, indem er mehrere Jahre hindurch den selben Boden bebauen konnte; dies
hatte wiederum zur Folge, daß er begann, feste Häuser zu konstruieren,
Baukonzeptionen zu entwerfen. „Das Haus des neolithischen Menschen ist ein
Warteraum, dessen Insassen ausharren, bis auf den Feldern am Rand des Dorfes der
Moment kommt, um dessen Willen man die Mühe des Bleibens auf sich genommen
hat - der Augenblick, in dem die angepflanzten Gräser zum Verzehr, zur Speicherung
und Wiederaussaat geeignet sind.“ (
).
Zahlreiche kulturelle Innovationen stellten sich als Folge der Einführung
der produzierenden Wirtschaftsweise ein: sie erlaubte es dem Menschen seßhaft
zu werden, indem er mehrere Jahre hindurch den selben Boden bebauen konnte; dies
hatte wiederum zur Folge, daß er begann, feste Häuser zu konstruieren,
Baukonzeptionen zu entwerfen. „Das Haus des neolithischen Menschen ist ein
Warteraum, dessen Insassen ausharren, bis auf den Feldern am Rand des Dorfes der
Moment kommt, um dessen Willen man die Mühe des Bleibens auf sich genommen
hat - der Augenblick, in dem die angepflanzten Gräser zum Verzehr, zur Speicherung
und Wiederaussaat geeignet sind.“ ( ).
Die ersten Seßhaften entwickelten den ersten Architekturkult in den ersten
Städten, die als Märkte an Flüssen errichtet wurden. Der Quader
wurde zum Grundelement der Architektur. Es entstanden auch erste Sakralbauten,
und man begann jetzt auch mit dem polygonalen Mauerbau. Diese „immunologische“
Sphäre diente dem Schutz vor Feinden, aber auch der Identität sozio-ökonomischer
Gemeinschaften. Macht in einer Stadt hatte z.B. in Mesopotamien (
).
Die ersten Seßhaften entwickelten den ersten Architekturkult in den ersten
Städten, die als Märkte an Flüssen errichtet wurden. Der Quader
wurde zum Grundelement der Architektur. Es entstanden auch erste Sakralbauten,
und man begann jetzt auch mit dem polygonalen Mauerbau. Diese „immunologische“
Sphäre diente dem Schutz vor Feinden, aber auch der Identität sozio-ökonomischer
Gemeinschaften. Macht in einer Stadt hatte z.B. in Mesopotamien ( )
ein Priesterkönig als Stellvertreter Gottes, dem die Stadt gehörte.
Als Konsequenz aus der Ökonomie gab es weitere technologische Neuerungen:
die vielseitige Wirtschaft erforderte nämlich neue Geräte für neue
Funktionen; daraus erwuchs das Bedürfnis nach neuen, besseren Rohstoffen,
die oft von weither eingetauscht werden mußten, womit der Handel und damit
die Kommunikation gefördert wurden. Anhäufung von Reichtum entstand
dadurch, daß man begann, mehr als notwendig einzutauschen. Eine wichtige
Innovation war die Erfindung der Keramik - heute das wichtigste archäologische
Arbeitsmittel für die Gliederung urgeschichtlicher Zeitabschnitte -, oder
die Einführung der künstlichen Bewässerung zur Sicherung des landwirtschaftlichen
Ertrages. Durch den Anbau konnten in einem kleinen Siedlungsraum mehr Leute als
vorher ernährt werden, d.h. es entstanden Zusammenschlüsse mehrerer
Familien, die in einer Dorfgemeinschaft lebten. Die Rodung, Bebauung und Ernte
der Felder oder die künstliche Bewässerung waren nur als Gemeinschaftsleistungen
möglich, so daß die in einem Dorf lebende Gesellschaft organisiert
werden mußte. Eine völlig neue Sozialstruktur hatte die nunmehr notwendigen
Gemeinschaftsarbeiten und das Funktionieren einer dörflichen Gesellschaft
zu gewährleisten. Der Vegetationszyklus „Säen, Reifen, Ernten“
fand seinen Niederschlag in religiösen Vorstellungen und wurde verglichen
mit dem Lebenszyklus: „Geburt, Werden, Tod“. Mit dem Beginn der produzierenden
Wirtschaftsweise war ein starker Bevölkerungsanstieg verbunden: durch den
Anbau von Getreide und durch die spätere Tierhaltung konnten mehr Menschen
ernährt werden; diese größer werdende Gemeinschaft konnte wiederum
mehr Felder bewirtschaften, womit wieder mehr Menschen Ernährung fanden u.s.w..
Der Mensch bekam hierdurch auch ein anderes Verhältnis zu Grund und Boden,
den er, wollte er ihn langfristig bewirtschaften, ständig beanspruchen und
in seinem Besitz halten mußte. Daraus erwuchsen nicht nur andere Beziehungen
zum Eigentum, sondern auch Machtansprüche und somit Konfliktstoffe mit benachbarten
Gemeinschaften. Gruppenaggressionen, die man bei Jäger- und Sammlervölkern
kaum findet, waren die Folge.
)
ein Priesterkönig als Stellvertreter Gottes, dem die Stadt gehörte.
Als Konsequenz aus der Ökonomie gab es weitere technologische Neuerungen:
die vielseitige Wirtschaft erforderte nämlich neue Geräte für neue
Funktionen; daraus erwuchs das Bedürfnis nach neuen, besseren Rohstoffen,
die oft von weither eingetauscht werden mußten, womit der Handel und damit
die Kommunikation gefördert wurden. Anhäufung von Reichtum entstand
dadurch, daß man begann, mehr als notwendig einzutauschen. Eine wichtige
Innovation war die Erfindung der Keramik - heute das wichtigste archäologische
Arbeitsmittel für die Gliederung urgeschichtlicher Zeitabschnitte -, oder
die Einführung der künstlichen Bewässerung zur Sicherung des landwirtschaftlichen
Ertrages. Durch den Anbau konnten in einem kleinen Siedlungsraum mehr Leute als
vorher ernährt werden, d.h. es entstanden Zusammenschlüsse mehrerer
Familien, die in einer Dorfgemeinschaft lebten. Die Rodung, Bebauung und Ernte
der Felder oder die künstliche Bewässerung waren nur als Gemeinschaftsleistungen
möglich, so daß die in einem Dorf lebende Gesellschaft organisiert
werden mußte. Eine völlig neue Sozialstruktur hatte die nunmehr notwendigen
Gemeinschaftsarbeiten und das Funktionieren einer dörflichen Gesellschaft
zu gewährleisten. Der Vegetationszyklus „Säen, Reifen, Ernten“
fand seinen Niederschlag in religiösen Vorstellungen und wurde verglichen
mit dem Lebenszyklus: „Geburt, Werden, Tod“. Mit dem Beginn der produzierenden
Wirtschaftsweise war ein starker Bevölkerungsanstieg verbunden: durch den
Anbau von Getreide und durch die spätere Tierhaltung konnten mehr Menschen
ernährt werden; diese größer werdende Gemeinschaft konnte wiederum
mehr Felder bewirtschaften, womit wieder mehr Menschen Ernährung fanden u.s.w..
Der Mensch bekam hierdurch auch ein anderes Verhältnis zu Grund und Boden,
den er, wollte er ihn langfristig bewirtschaften, ständig beanspruchen und
in seinem Besitz halten mußte. Daraus erwuchsen nicht nur andere Beziehungen
zum Eigentum, sondern auch Machtansprüche und somit Konfliktstoffe mit benachbarten
Gemeinschaften. Gruppenaggressionen, die man bei Jäger- und Sammlervölkern
kaum findet, waren die Folge.
Anstatt nur zu sammeln, was die Natur hergibt, bauen die Seßhaften Getreide an und halten Vieh - man sollte nicht vergessen, daß diese Fähigkeit, landwirtschaftliche Nahrung zu erzeugen, bis in unsere Gegenwart eine Grundlage geblieben ist. Seit der Zeit, als Getreide angebaut und Haustiere gezüchtet werden, um das Nahrungsangebot zu vergrößern, können die Bauern ganzjährig an einem Ort bleiben, auch große dauerhafte Behausungen bauen, in denen sie viele Gerätschaften unterbringen. Die Züchtung von Haustieren betrieben zwar schon im Jungpaläolitikum einige der Nomaden - vielleicht waren sie Halbseßhafte (Halbnomaden) -, doch geschah dies eher aus Gründen der spezialisierten Jagd, also aus Gründen mehr der aneignenden als der produzierenden Wirtschaftsweise. Durch die produzierende Wirtschaftsweise bekam die Haustierzüchtung einen zweiten Aspekt, der aber viel weitreichendere Folgen haben sollte als der erste Aspekt. Auch ein dritter Aspekt sollte später noch hinzukommen: Haustierzüchtung aus Luxusgründen bzw. Komfortgründen.
Wenn eine Enklave aus
der Umgebung ausgegrenzt und eine sphärische (bzw. atmosphärische) Differenz
zwischen Innenraum und Außenraum stabilisiert wird, so kann man allein diese
Formulierung schon als eine „Definition des Hauses gelten lassen, sofern
man davon ausgehen kann, daß Häuser neben ihren Funktionen als Schutzraum,
als Arbeitsraum, als Schlafraum und Versammlungsraum immer auch eine implizite
Funktion als Klimaregler haben“ ( ),
doch man sollte trotzdem nicht vergessen, warum sie sich durch den Saat-Ernte-Zusammenhang
von den Hütten (
),
doch man sollte trotzdem nicht vergessen, warum sie sich durch den Saat-Ernte-Zusammenhang
von den Hütten ( )
unterscheiden: Häuser entstanden mit dem Ernteprojekt, obwohl, wie schon
erwähnt, in ihnen auch die Funktionen aller vorherigen Wohnungen enthalten
waren, sind und sein werden. Alle Wohnungen gehen zurück bis zu den Hüllen
(
)
unterscheiden: Häuser entstanden mit dem Ernteprojekt, obwohl, wie schon
erwähnt, in ihnen auch die Funktionen aller vorherigen Wohnungen enthalten
waren, sind und sein werden. Alle Wohnungen gehen zurück bis zu den Hüllen
( ),
die sie immer auch waren, sind und sein werden.
),
die sie immer auch waren, sind und sein werden.
„Explikationsbedingte
Neueinführungen rufen tatsächlich oft den Eindruck hervor, als seien
aggressive neue Mitbewohner ins »Haus des Seins« ( )
eingezogen, für die kein angemessener Raum zur Verfügung stand, woraufhin
sie sich gleichsam mit Gewalt einquartierten. Kein Wunder, wenn dies zuweilen
als »revolutionäre« Turbulenz beschrieben wurde. Es besteht,
um an eines der grellsten Einführungsdramen zu erinnern, kein Zweifel daran,
daß die Explikation der Schrift durch den Druck mit beweglichen Lettern
die gesamte Ökologie der europäischen Zivilisation nach 1500
durcheinandergeworfen hat. (
)
eingezogen, für die kein angemessener Raum zur Verfügung stand, woraufhin
sie sich gleichsam mit Gewalt einquartierten. Kein Wunder, wenn dies zuweilen
als »revolutionäre« Turbulenz beschrieben wurde. Es besteht,
um an eines der grellsten Einführungsdramen zu erinnern, kein Zweifel daran,
daß die Explikation der Schrift durch den Druck mit beweglichen Lettern
die gesamte Ökologie der europäischen Zivilisation nach 1500
durcheinandergeworfen hat. ( ).
Man kann so weit gehen zu sagen, die nach-Gutenbergsche Welt (
).
Man kann so weit gehen zu sagen, die nach-Gutenbergsche Welt ( )
stelle den Versuch dar, die für den ersten Blick harmlosen Neuankömmlinge,
die in den Setzereien unter der Gestalt kleiner Bleistücke auftraten, in
eine erträgliche Kohabitation mit den übrigen Kulturtatsachen, insbesondere
den religiösen Überzeugungen der Menschen, einzubeziehen - Beweis durch
Gelingen: die neuzeitliche Literatur und das Schulwesen der Nationalstaaten; Beweis
durch Mißlingen: die verhängnisvolle Rolle der Druckerpressen als Träger
der nationalistischen Bewußtseinsdeformation, als Alliierte sämtlicher
ideologischen Perversionen und als Verbreiter und Beschleuniger der kollektiven
Hysterien. Gabriel Tarde bezeichnete die Wirkungen des Buchdrucks zu Recht als
eine »erstaunliche Invasion«, die der Illusion Vorschub leistete,
»Bücher seien die Quelle der Wahrheit«.“ (
)
stelle den Versuch dar, die für den ersten Blick harmlosen Neuankömmlinge,
die in den Setzereien unter der Gestalt kleiner Bleistücke auftraten, in
eine erträgliche Kohabitation mit den übrigen Kulturtatsachen, insbesondere
den religiösen Überzeugungen der Menschen, einzubeziehen - Beweis durch
Gelingen: die neuzeitliche Literatur und das Schulwesen der Nationalstaaten; Beweis
durch Mißlingen: die verhängnisvolle Rolle der Druckerpressen als Träger
der nationalistischen Bewußtseinsdeformation, als Alliierte sämtlicher
ideologischen Perversionen und als Verbreiter und Beschleuniger der kollektiven
Hysterien. Gabriel Tarde bezeichnete die Wirkungen des Buchdrucks zu Recht als
eine »erstaunliche Invasion«, die der Illusion Vorschub leistete,
»Bücher seien die Quelle der Wahrheit«.“ ( ).
Kein Wunder, denn Gutenbergs Buchdruck bewirkte, daß das Privileg einer
Minderheit am geistig-intellektuellen Prozeß von der Mitbestimmung einer
immer größer werdenden Mehrheit abhängig werden konnte und auch
sofort wurde: mit gigantischen Auswirkungen, und zwar in allen Bereichen.
).
Kein Wunder, denn Gutenbergs Buchdruck bewirkte, daß das Privileg einer
Minderheit am geistig-intellektuellen Prozeß von der Mitbestimmung einer
immer größer werdenden Mehrheit abhängig werden konnte und auch
sofort wurde: mit gigantischen Auswirkungen, und zwar in allen Bereichen.
„Die
moderne Baukunst ( )
hat das Haus, diesen menschen-ermöglichenden Zusatz zur Natur, in Elemente
zerlegt und neu angeschrieben, es hat die Stadt, die früher die Welt im Kreis
um sich herum disponierte, aus der Mitte gerückt und zum Standort in einem
Netzwerk aus Flüssen und Strahlen umgebildet. Die analytische »Revolution«,
die das Zentralnervensystem der Moderne ausmacht, hat damit auch die architektonischen
Hüllen der Humansphäre erfaßt und durch die Aufstellung eines
Formen-Alphabets eine neue Kunst der Synthesis, eine moderne Grammatik der Raum-Erzeugung
und eine veränderte Lage des Existierens im artifiziellen Milieu hervorgebracht.“
(
)
hat das Haus, diesen menschen-ermöglichenden Zusatz zur Natur, in Elemente
zerlegt und neu angeschrieben, es hat die Stadt, die früher die Welt im Kreis
um sich herum disponierte, aus der Mitte gerückt und zum Standort in einem
Netzwerk aus Flüssen und Strahlen umgebildet. Die analytische »Revolution«,
die das Zentralnervensystem der Moderne ausmacht, hat damit auch die architektonischen
Hüllen der Humansphäre erfaßt und durch die Aufstellung eines
Formen-Alphabets eine neue Kunst der Synthesis, eine moderne Grammatik der Raum-Erzeugung
und eine veränderte Lage des Existierens im artifiziellen Milieu hervorgebracht.“
( ).
).

|
Die
Explizitmachung des Wohnens begann wahrscheinlich deshalb fast zeitgleich mit
der sehr berüchtigten Industriellen Revolution ( ),
weil sie selbst - ebenso wie die sie begleitende Bürgerliche Revolution
- auch eine Explikation war und den Startschuß gab für unsere
Moderne (
),
weil sie selbst - ebenso wie die sie begleitende Bürgerliche Revolution
- auch eine Explikation war und den Startschuß gab für unsere
Moderne ( ),
die man zwar auch die 2. Halbzeit unserer Neuzeit nennen kann, aber dennoch
ihre Eigenart hat. Die Explizitmachung des Wohnens benötigte aber, um wirklich
eine Explikation des Wohnens zum Höhepunkt zu treiben, noch solche Modifikationen,
die wohl nur eine große Krise mit sich bringen kann. Deshalb wurde nicht
zufällig dieser Höhepunkt über den Tiefpunkt namens Weltkrieg(e)
erreicht. „Wäre in kürzester Form zu erklären, welche Modifikationen
das 20. Jahrhundert am menschlichen In-der-Welt-Sein (
),
die man zwar auch die 2. Halbzeit unserer Neuzeit nennen kann, aber dennoch
ihre Eigenart hat. Die Explizitmachung des Wohnens benötigte aber, um wirklich
eine Explikation des Wohnens zum Höhepunkt zu treiben, noch solche Modifikationen,
die wohl nur eine große Krise mit sich bringen kann. Deshalb wurde nicht
zufällig dieser Höhepunkt über den Tiefpunkt namens Weltkrieg(e)
erreicht. „Wäre in kürzester Form zu erklären, welche Modifikationen
das 20. Jahrhundert am menschlichen In-der-Welt-Sein ( )
bewirkt hat, müßte die Auskunft lauten: Es hat die Existenz als Aufenthalt
architektonisch, ästhetisch, juristisch entfaltet - oder einfacher: es hat
das Wohnen explizit gemacht.“ (
)
bewirkt hat, müßte die Auskunft lauten: Es hat die Existenz als Aufenthalt
architektonisch, ästhetisch, juristisch entfaltet - oder einfacher: es hat
das Wohnen explizit gemacht.“ ( ).
Also: „Die wirkliche »Raumrevolution« des 20. Jahrhunderts ist
die Explikation des menschlichen Aufenthalts oder der Bleibe in einem Interieur
durch die Wohnmaschine, das Klimadesign und die Environment-Planung (bis hin zu
den Großformen, die wir die Kollektoren nennen) sowie die Exploration der
Nachbarschaft mit den beiden unmenschlichen Raum-Strukturen, die dem menschlichen
vorgelagert oder beigeordnet sind, dem kosmischen (Makro und Mikro) und dem virtuellen.
Um den Aufenthalt von Personen an bewohnten Orten explikabel zu machen, war in
der Tat nicht weniger vonnöten als eine Umkehrung der Beziehung zwischen
Vordergrund und Hintergrund hinsichtlich der menschlichen Beherbungsverhältnisse.
In Heideggers Perspektive und Tonart gesprochen: Das In-Sein-in-Etwas-überhaupt
mußte aus den Fugen geraten sein, ehe es ausdrücklich als Einwohnen-in-der-Welt
ins Thema gehoben werden konnte. Während traditionell die Wohnbehausungen
den tragenden Hintergrund von Lebensprozessen bildeten, wird in der scharfen Luft
der Modernität auch das »lebensweltliche« Dasein von der Umweltumkehrung
erfaßt. Den Selbstverständlichkeiten des Wohnens gelingt es nicht länger,
im Hintergrund zu bleiben. Auch wenn wir Häuser und Wohnungen nicht immer
ins Vakuum projizieren: sie müssen künftig so explizit formuliert werden,
als wären sie die nächsten Verwandten der Raumkapsel. (
).
Also: „Die wirkliche »Raumrevolution« des 20. Jahrhunderts ist
die Explikation des menschlichen Aufenthalts oder der Bleibe in einem Interieur
durch die Wohnmaschine, das Klimadesign und die Environment-Planung (bis hin zu
den Großformen, die wir die Kollektoren nennen) sowie die Exploration der
Nachbarschaft mit den beiden unmenschlichen Raum-Strukturen, die dem menschlichen
vorgelagert oder beigeordnet sind, dem kosmischen (Makro und Mikro) und dem virtuellen.
Um den Aufenthalt von Personen an bewohnten Orten explikabel zu machen, war in
der Tat nicht weniger vonnöten als eine Umkehrung der Beziehung zwischen
Vordergrund und Hintergrund hinsichtlich der menschlichen Beherbungsverhältnisse.
In Heideggers Perspektive und Tonart gesprochen: Das In-Sein-in-Etwas-überhaupt
mußte aus den Fugen geraten sein, ehe es ausdrücklich als Einwohnen-in-der-Welt
ins Thema gehoben werden konnte. Während traditionell die Wohnbehausungen
den tragenden Hintergrund von Lebensprozessen bildeten, wird in der scharfen Luft
der Modernität auch das »lebensweltliche« Dasein von der Umweltumkehrung
erfaßt. Den Selbstverständlichkeiten des Wohnens gelingt es nicht länger,
im Hintergrund zu bleiben. Auch wenn wir Häuser und Wohnungen nicht immer
ins Vakuum projizieren: sie müssen künftig so explizit formuliert werden,
als wären sie die nächsten Verwandten der Raumkapsel. ( ).
Hieraus ergibt sich die Definition der Architektur der Moderne (
).
Hieraus ergibt sich die Definition der Architektur der Moderne ( ):
Sie ist das Medium, in dem sich die Explikation des menschlichen Aufenthalts in
menschengemachten Interieurs prozeßhaft artikuliert. Demnach stellt die
Baukunst seit dem (Ende des 18.) 19. Jahrhundert
etwas dar, was man im Vormärz eine »Verwirklichung der Philosophie«
genannt hätte. Um noch einmal mit Heidegger zu reden: Sie vollzieht die Er-Örterung
des Daseins. Sie begnügt sich nicht damit, die mehr oder weniger kunstbewußte
Handlangerin der Behausungstätigkeit von Menschen zu sein, deren Spuren sich
bis in das frühe Arrangement von Lagerstätten, Höhlen und Hütten
zurückverfolgen lassen. Sie reformuliert die »Orte«, an denen
so etwas wie Wohnen, Bleibe und Bei-sich-Sein von Gruppen und Individuen unter
Bedingungen hoher Selbstbezüglichkeit, hoher Geldvermitteltheit, hoher Verrechtlichung,
hoher Vernetzung und hoher Mobilisierung stattfinden kann.“ (
):
Sie ist das Medium, in dem sich die Explikation des menschlichen Aufenthalts in
menschengemachten Interieurs prozeßhaft artikuliert. Demnach stellt die
Baukunst seit dem (Ende des 18.) 19. Jahrhundert
etwas dar, was man im Vormärz eine »Verwirklichung der Philosophie«
genannt hätte. Um noch einmal mit Heidegger zu reden: Sie vollzieht die Er-Örterung
des Daseins. Sie begnügt sich nicht damit, die mehr oder weniger kunstbewußte
Handlangerin der Behausungstätigkeit von Menschen zu sein, deren Spuren sich
bis in das frühe Arrangement von Lagerstätten, Höhlen und Hütten
zurückverfolgen lassen. Sie reformuliert die »Orte«, an denen
so etwas wie Wohnen, Bleibe und Bei-sich-Sein von Gruppen und Individuen unter
Bedingungen hoher Selbstbezüglichkeit, hoher Geldvermitteltheit, hoher Verrechtlichung,
hoher Vernetzung und hoher Mobilisierung stattfinden kann.“ ( ).
).
 |
„Sobald sich der Zusammenhang von Wohnen und Warten verwirrt, wie
traditionell in Perioden der militärischen Krise und systematisch
seit der Industriellen Revolution ( )
mit ihren Folgen an De-Agrarisierung des Lebens, kann es dazu kommen,
daß die Existierenden ihre Orientierung am maßgeblichen kurzweiligen
Augenblick der Ernte verlieren. Wie, wenn der Sommer kommt, und auf den
Feldern ist nichts mehr, was man einbringen könnte? Heidegger
hat diese bedrohliche Möglichkeit in seiner Analytik der Langeweile
evokativ beschrieben: »Dieses Langwerden der Weile offenbart
die Weile des Daseins in ihrer schlechthin nie bestimmbaren Unbestimmtheit.
Diese nimmt das Dasein gefangen, aber so, daß es in der ganzen weiten
und geweiteten Weile nichts fassen kann als nur, daß es in ihr und
an sie gebannt bleibt. .... Das Langwerden ist ein Verschwinden der
Kürze der Weile.« (Martin Heidegger, Die Grundbegriffe
der Metaphysik, 1929-1930, S. 229
)
mit ihren Folgen an De-Agrarisierung des Lebens, kann es dazu kommen,
daß die Existierenden ihre Orientierung am maßgeblichen kurzweiligen
Augenblick der Ernte verlieren. Wie, wenn der Sommer kommt, und auf den
Feldern ist nichts mehr, was man einbringen könnte? Heidegger
hat diese bedrohliche Möglichkeit in seiner Analytik der Langeweile
evokativ beschrieben: »Dieses Langwerden der Weile offenbart
die Weile des Daseins in ihrer schlechthin nie bestimmbaren Unbestimmtheit.
Diese nimmt das Dasein gefangen, aber so, daß es in der ganzen weiten
und geweiteten Weile nichts fassen kann als nur, daß es in ihr und
an sie gebannt bleibt. .... Das Langwerden ist ein Verschwinden der
Kürze der Weile.« (Martin Heidegger, Die Grundbegriffe
der Metaphysik, 1929-1930, S. 229 ).
Was Heidegger hier zur Sprache bringt, ist der Terror der Arbeitslosigkeit,
der sich als Nichts-zu-tun-Haben zeigt. Die Kurzweiligkeit hat nur dann
eine Chance, unser Zeiterleben zu durchgreifen, wenn wir einbezogen sind
in den fruchtbaren Augenblick, der uns von sich her sagt, was jetzt zu
tun ist. Der kategorische Imperativ der Agrarontologie: Verwende dich
für die Ernte! ist nur befolgbar, solange zwischen Voraussicht und
Erfüllung eine sinnvolle Spannung besteht. Demnach wäre das
Haus der ersten Bauern eine bewohnte Uhr. Es ist die Geburtsstätte
zweier Arten von Zeitlichkeit - der Zeit, die auf ein Ereignis zuläuft,
und der Zeit, die wie im Kreis gehend der ewigen Wiederkehr des Gleichen
dient. Durch ihre Zugehörigkeit zum ersten Projekt - dem Saat-Ernte-Zusammenhang
- unterscheiden sich Häuser von den Hütten (
).
Was Heidegger hier zur Sprache bringt, ist der Terror der Arbeitslosigkeit,
der sich als Nichts-zu-tun-Haben zeigt. Die Kurzweiligkeit hat nur dann
eine Chance, unser Zeiterleben zu durchgreifen, wenn wir einbezogen sind
in den fruchtbaren Augenblick, der uns von sich her sagt, was jetzt zu
tun ist. Der kategorische Imperativ der Agrarontologie: Verwende dich
für die Ernte! ist nur befolgbar, solange zwischen Voraussicht und
Erfüllung eine sinnvolle Spannung besteht. Demnach wäre das
Haus der ersten Bauern eine bewohnte Uhr. Es ist die Geburtsstätte
zweier Arten von Zeitlichkeit - der Zeit, die auf ein Ereignis zuläuft,
und der Zeit, die wie im Kreis gehend der ewigen Wiederkehr des Gleichen
dient. Durch ihre Zugehörigkeit zum ersten Projekt - dem Saat-Ernte-Zusammenhang
- unterscheiden sich Häuser von den Hütten ( ),
mit denen sie lange eng verwandt, formal oft zum Verwechseln ähnlich
blieben. Zwar enthält das primitive Haus die vorzeitliche Hütte
und hebt sie auf, soweit es deren Funktionen übernimmt: die Bergung
des Schlafs, den Wetter- und Ungezieferschutz, die Bereitstellung einer
Rückzugssphäre für Sexuelles und einer Komfortsphäre
für verdauungsträge Zustände. Umgekehrt kann die Hütte
nie das Haus enthalten, weil sie kein Ernteprojekt hat und sich im Obdachgeben
von Tag zu Tag erschöpft. (Daher die Attraktivität der Hüttenexistenz
für von Projekten erschöpfte Zivilisierte, die während
ihrer Ferien in Zelten und Campingwagen ausschwärmen - zurückgezogen
in Container, die ihre Bewohner zu keinem Warten auf ein Produkt verpflichten;
hier kann man grillen, fernsehen, kopulieren und das Bruttoszialprodukt
vergessen.) ....“ (
),
mit denen sie lange eng verwandt, formal oft zum Verwechseln ähnlich
blieben. Zwar enthält das primitive Haus die vorzeitliche Hütte
und hebt sie auf, soweit es deren Funktionen übernimmt: die Bergung
des Schlafs, den Wetter- und Ungezieferschutz, die Bereitstellung einer
Rückzugssphäre für Sexuelles und einer Komfortsphäre
für verdauungsträge Zustände. Umgekehrt kann die Hütte
nie das Haus enthalten, weil sie kein Ernteprojekt hat und sich im Obdachgeben
von Tag zu Tag erschöpft. (Daher die Attraktivität der Hüttenexistenz
für von Projekten erschöpfte Zivilisierte, die während
ihrer Ferien in Zelten und Campingwagen ausschwärmen - zurückgezogen
in Container, die ihre Bewohner zu keinem Warten auf ein Produkt verpflichten;
hier kann man grillen, fernsehen, kopulieren und das Bruttoszialprodukt
vergessen.) ....“ ( ).
Auf den Vorschlag, Urlaub im Zelt oder im Wohnwagen zu machen, können
die der Menschen, die noch nie in einem Haus gewohnt haben, wohl nur negativ
regieren.
).
Auf den Vorschlag, Urlaub im Zelt oder im Wohnwagen zu machen, können
die der Menschen, die noch nie in einem Haus gewohnt haben, wohl nur negativ
regieren.
Dank
Heidegger - laut Sloterdijk „der größte Denker Alteuropas“
( )
- sind wir sehr vielen Phänomenen erheblich näher gekommen, besonders
den Phänomenen des Alltäglichen, und dazu zählt vor allem auch
das Wohnen. Vor Heidegger haben sich nur sehr wenige Philosophen mit Phänomenen
des Alltags beschäftigt, und die sehr wenigen, die es taten, haben bei weitem
nicht Heideggers Niveau erreicht: das Eindrucksvollste, was diesbezüglich
jemals vorgetragen, niedergeschrieben oder sonstwie zur Sprache gebracht worden
ist.
)
- sind wir sehr vielen Phänomenen erheblich näher gekommen, besonders
den Phänomenen des Alltäglichen, und dazu zählt vor allem auch
das Wohnen. Vor Heidegger haben sich nur sehr wenige Philosophen mit Phänomenen
des Alltags beschäftigt, und die sehr wenigen, die es taten, haben bei weitem
nicht Heideggers Niveau erreicht: das Eindrucksvollste, was diesbezüglich
jemals vorgetragen, niedergeschrieben oder sonstwie zur Sprache gebracht worden
ist.
Es bedurfte Entwicklungen wie z.B. der Industriellen Revolution ( )
und der sie begleitenden Erscheinungen - kurz gesagt: es bedurfte der Moderne
-, damit Philosophen, Wissenschaftler und andere Forscher überhaupt erst
auf die Idee kamen, sich dem Thema „Alltag“ zu widmen, denn der Traditionsbruch
ist die erste und die militärische Großkrise die zweite Bedingung.
Der Traditionsbruch scheint zunächt und allein für bestimmte Explikationen
aber noch zu harmlos zu sein - hier siegen häufig noch die Gegenmaßnahmen
(deshalb taucht zu dieser Zeit auch der Begriff des Reaktionären erstmals
auf) -, doch die militärische Großkrise macht mehr explizit, weil sie
von großen Kriegen (Beispiel: Weltkriege) begleitet ist und zumindest immer
eine Seite der Kriegsgegner so stark betrifft, daß hier der Bruch „total(itär)er“
vollzogen wird: gewollt oder ungewollt. Ob
Heidegger die Tradition retten wollte, um die Gegenwart vor dem Schlimmsten der
Zukunft zu bewahren, ist weniger entscheidend als die Tatsache, daß er in
die Zeit eintauchte und Phänomene entdeckte, die vor ihm noch niemand berücksichtigt
hatte. Wer das Ländliche und Bäuerliche gegenüber dem (Welt-)Städtischen
und Künstlichen lobt, an die Notwendigkeit der Beziehung zwischen Wohnen
und Schonen erinnert, weil die Modernen sie immer mehr zum Vergessen bringen,
der hat die Zukunft und die irreparablen Schäden schon berücksichtigt,
die wir „Umweltprobleme“ nennen. (
)
und der sie begleitenden Erscheinungen - kurz gesagt: es bedurfte der Moderne
-, damit Philosophen, Wissenschaftler und andere Forscher überhaupt erst
auf die Idee kamen, sich dem Thema „Alltag“ zu widmen, denn der Traditionsbruch
ist die erste und die militärische Großkrise die zweite Bedingung.
Der Traditionsbruch scheint zunächt und allein für bestimmte Explikationen
aber noch zu harmlos zu sein - hier siegen häufig noch die Gegenmaßnahmen
(deshalb taucht zu dieser Zeit auch der Begriff des Reaktionären erstmals
auf) -, doch die militärische Großkrise macht mehr explizit, weil sie
von großen Kriegen (Beispiel: Weltkriege) begleitet ist und zumindest immer
eine Seite der Kriegsgegner so stark betrifft, daß hier der Bruch „total(itär)er“
vollzogen wird: gewollt oder ungewollt. Ob
Heidegger die Tradition retten wollte, um die Gegenwart vor dem Schlimmsten der
Zukunft zu bewahren, ist weniger entscheidend als die Tatsache, daß er in
die Zeit eintauchte und Phänomene entdeckte, die vor ihm noch niemand berücksichtigt
hatte. Wer das Ländliche und Bäuerliche gegenüber dem (Welt-)Städtischen
und Künstlichen lobt, an die Notwendigkeit der Beziehung zwischen Wohnen
und Schonen erinnert, weil die Modernen sie immer mehr zum Vergessen bringen,
der hat die Zukunft und die irreparablen Schäden schon berücksichtigt,
die wir „Umweltprobleme“ nennen. ( ).
„Ich habe ... schon früh in Heidegger den eigentlichen Begründer
der »grünen« Bewegung gesehen, denn er war ja zumindest auch
ein Philosoph des Umweltschutzes oder der Umweltbewahrung“, so der Heidegger-Schüler
Ernst Nolte (
).
„Ich habe ... schon früh in Heidegger den eigentlichen Begründer
der »grünen« Bewegung gesehen, denn er war ja zumindest auch
ein Philosoph des Umweltschutzes oder der Umweltbewahrung“, so der Heidegger-Schüler
Ernst Nolte ( )
und auch Peter Sloterdijk, denn für ihn ist Heidegger als „der erste
Chirotopologe“ (
)
und auch Peter Sloterdijk, denn für ihn ist Heidegger als „der erste
Chirotopologe“ ( )
auch „der erste Ökologe“ (
)
auch „der erste Ökologe“ ( )
bzw. „der erste Ökosoph“ (
)
bzw. „der erste Ökosoph“ ( ).
Er hat explizit gemacht: „Weil die Menscheninsel (
).
Er hat explizit gemacht: „Weil die Menscheninsel ( )
ein Chirotop ist, wo kluge Hände mit Zeug (
)
ein Chirotop ist, wo kluge Hände mit Zeug ( )
zurechtkommen, sind die Insulaner manipulative Realisten und luxurierende Treibhausgeschöpfe
zugleich.“ (
)
zurechtkommen, sind die Insulaner manipulative Realisten und luxurierende Treibhausgeschöpfe
zugleich.“ ( ).
Logisch: aktiv sind sie Belastende und Entlastende, passiv sind sie Belastete
und Entlastete. „Auf der einen Seite bewähren sie sich als werkzeugbewehrte
Überlebenskämpfer, erfolgsbewußte Kooperateure, listige Plänemacher;
auf der anderen sind sie für immer entwaffnete Nestbewohner, zitternde Ekstatiker,
erwachsene Föten, die in die Weltnacht horchen und Götterbesuch empfangen.“
(
).
Logisch: aktiv sind sie Belastende und Entlastende, passiv sind sie Belastete
und Entlastete. „Auf der einen Seite bewähren sie sich als werkzeugbewehrte
Überlebenskämpfer, erfolgsbewußte Kooperateure, listige Plänemacher;
auf der anderen sind sie für immer entwaffnete Nestbewohner, zitternde Ekstatiker,
erwachsene Föten, die in die Weltnacht horchen und Götterbesuch empfangen.“
( ).
Sloterdijks 1. Chirotopologe und 1. Ökologe bzw. 1. Ökosoph Heidegger
kann deswegen zugleich auch als „der größte Denker Alteuropas“
(
).
Sloterdijks 1. Chirotopologe und 1. Ökologe bzw. 1. Ökosoph Heidegger
kann deswegen zugleich auch als „der größte Denker Alteuropas“
( )
gelten, weil er die Tradition, den Bruch und als Synthesis auch die Rettung
so sehr in sein „riesenhaftes Werk“ (
)
gelten, weil er die Tradition, den Bruch und als Synthesis auch die Rettung
so sehr in sein „riesenhaftes Werk“ ( )
integrierte, daß nach ihm diesbezüglich fast nichts mehr zu sagen übrig
bleibt. Man muß sich mit Heidegger auseinandersetzen - ob man will oder
nicht, ist egal, denn man kommt an ihm nicht vorbei. Und: Eine Welt ohne Wohner
wäre eine Welt ohne Schoner, eine Welt ohne Bauern und Techniker wäre
wie eine Welt ohne Bodenbau und Überbau, ohne Leben und Überleben.
)
integrierte, daß nach ihm diesbezüglich fast nichts mehr zu sagen übrig
bleibt. Man muß sich mit Heidegger auseinandersetzen - ob man will oder
nicht, ist egal, denn man kommt an ihm nicht vorbei. Und: Eine Welt ohne Wohner
wäre eine Welt ohne Schoner, eine Welt ohne Bauern und Techniker wäre
wie eine Welt ohne Bodenbau und Überbau, ohne Leben und Überleben.
„Die
bäuerliche Welt kennt nur den Advent, nicht das Projekt; ihre Vernunft entspringt
aus der Meditation über die Nutzpflanze und ihre kosmischen Analogien. Allein
durch die Tatsache, daß Aussaat stattfindet, wird auch im bäuerlichen
Universum schon das investierende Handeln präfiguriert, mit dem die Einführung
des Gewinngedankens in die Zeit Form annimmt; dieses Gewinndenken bleibt aber
noch diskret und hintergründig. Für die ... agrarische Welt ... kann
Heideggers Bemerkung gelten, daß das Schonen den »Grundzug des Wohnens«
bilde. ( ).
So spricht ... der letzte Prophet des Seins-wie-die-Pflanzen. Er war, man versteht
es im Rückblick auf sein riesenhaftes Werk, der ans Ende seiner Epoche versetzte
Proto-Ontologe des vegetativen Aufgehens und Gedeihenlassens. Inmitten von entgrenzten
Produktionen, Investitionen und Bombardierungen begreift der größte
Denker Alteuropas, auf der Schwelle zwischen Wachstumswelt und Projektwelt zögernd,
noch immer das unspektakuläre Eintreten der Reife als den Archetypus des
maßgeblichen Ereignisses.“ (
).
So spricht ... der letzte Prophet des Seins-wie-die-Pflanzen. Er war, man versteht
es im Rückblick auf sein riesenhaftes Werk, der ans Ende seiner Epoche versetzte
Proto-Ontologe des vegetativen Aufgehens und Gedeihenlassens. Inmitten von entgrenzten
Produktionen, Investitionen und Bombardierungen begreift der größte
Denker Alteuropas, auf der Schwelle zwischen Wachstumswelt und Projektwelt zögernd,
noch immer das unspektakuläre Eintreten der Reife als den Archetypus des
maßgeblichen Ereignisses.“ ( ).
Doch gerade weil Heidegger die Projektwelt sehr gut kannte, erlaubte er sich mit
Recht gegenüber diesem Nach-vorn-Geworfenen allerlei Gegen-Vorwürfe.
).
Doch gerade weil Heidegger die Projektwelt sehr gut kannte, erlaubte er sich mit
Recht gegenüber diesem Nach-vorn-Geworfenen allerlei Gegen-Vorwürfe.
„Heidegger,
dem die Phänomenologie des Wohnens (zusammen mit seinen Nachfolgern Bollnow
und Schmitz )
noch immer am meisten verdankt, hat den Zusammenhang zwischen dem Wohnen und dem
Warten auf Zeichen des Ungewöhnlichen als Matrix der religiösen oder
besinnlichen Rezeptivität erläutert: »Die Sterblichen wohnen,
insofern sie die Göttlichen als die Göttlichen erwarten. Hoffend halten
sie ihnen das Unverhoffte entgegen. Sie warten der Winke ihrer Ankunft und verkennen
nicht die Zeichen ihres Fehls .... Im Unheil noch warten sie des entzogenen Heils.«
(
)
noch immer am meisten verdankt, hat den Zusammenhang zwischen dem Wohnen und dem
Warten auf Zeichen des Ungewöhnlichen als Matrix der religiösen oder
besinnlichen Rezeptivität erläutert: »Die Sterblichen wohnen,
insofern sie die Göttlichen als die Göttlichen erwarten. Hoffend halten
sie ihnen das Unverhoffte entgegen. Sie warten der Winke ihrer Ankunft und verkennen
nicht die Zeichen ihres Fehls .... Im Unheil noch warten sie des entzogenen Heils.«
( ).
In profanere Ausdrücke übersetzt (und unter Absehung davon, daß
man es mit Paraphrasen zu Hölderlins poetischer Theologie zu tun hat), ergibt
das die Aussage, daß wohnende Menschen sich in einer Trivialität einhausen,
die es ihnen erst erlaubt, das Nicht-Triviale zu unterscheiden.“ (
).
In profanere Ausdrücke übersetzt (und unter Absehung davon, daß
man es mit Paraphrasen zu Hölderlins poetischer Theologie zu tun hat), ergibt
das die Aussage, daß wohnende Menschen sich in einer Trivialität einhausen,
die es ihnen erst erlaubt, das Nicht-Triviale zu unterscheiden.“ ( ).
Diese Differenzierung geschieht nicht durch ein theoretisches Urteil, sondern
durch die Willigkeit und Fähigkeit des von Gewohnheiten strukturierten Lebens,
mit Ungewohntem, das bei einem ankommt, etwas anzufangen. In Wohnbehälter
festgesetzte Menschen wollen die Erlösung von der Trivialität, z.B.
von dem Dasitzen im Eigenen, von dem Warten auf einen Anruf, von dem langweiligen
Apartmentleben, von der Reizarmut im Hausleben, von der Armut des eigenen Erlebens
u.s.w. u.s.w. u.s.w.. Immer mehr meldet sich der Hunger nach Wundern, nach High-Lights,
nach News, nach jedem Hinweis darauf, daß irgendwo doch noch etwas
los ist.
).
Diese Differenzierung geschieht nicht durch ein theoretisches Urteil, sondern
durch die Willigkeit und Fähigkeit des von Gewohnheiten strukturierten Lebens,
mit Ungewohntem, das bei einem ankommt, etwas anzufangen. In Wohnbehälter
festgesetzte Menschen wollen die Erlösung von der Trivialität, z.B.
von dem Dasitzen im Eigenen, von dem Warten auf einen Anruf, von dem langweiligen
Apartmentleben, von der Reizarmut im Hausleben, von der Armut des eigenen Erlebens
u.s.w. u.s.w. u.s.w.. Immer mehr meldet sich der Hunger nach Wundern, nach High-Lights,
nach News, nach jedem Hinweis darauf, daß irgendwo doch noch etwas
los ist.
 „Absolute Inseln entstehen durch die Radikalisierung des Prinzips der Enklavenbildung“,
sagt der Philosoph Peter Sloterdijk (
„Absolute Inseln entstehen durch die Radikalisierung des Prinzips der Enklavenbildung“,
sagt der Philosoph Peter Sloterdijk ( ).
Die Isolation ist es nämlich, welche die Insel zu dem macht, was sie ist.
Inseln sind Weltmodelle in der Welt. Kultur ist ein Text - Kultur ist eine Syntax.
Kultur ist ein Gebäude - Kultur folgt einer Raum-Erzeugungsregel.
).
Die Isolation ist es nämlich, welche die Insel zu dem macht, was sie ist.
Inseln sind Weltmodelle in der Welt. Kultur ist ein Text - Kultur ist eine Syntax.
Kultur ist ein Gebäude - Kultur folgt einer Raum-Erzeugungsregel.
 Absolute Inseln, atmosphärische Inseln, anthropogene Inseln |
„Soll also die Isolation dreidimensional werden und freie Navigationen
im Umgebungselement ermöglichen, ist die Rahmung der Insel nicht mehr durch
das Aufeinandertreffen von Land und Meer an einem Küstensaum herzustellen.
Absolute Inseln haben keine Küste, sondern Außenwände, und zwar
auf allen Seiten. Von diesen verlangt man eine perfekte Dichtung - wer aus ihnen
in ins Umgebende steigen möchte, muß darauf gefaßt sein, daß
es sofort ins Tiefe geht; das Baden im All ist nur mit Hilfe von Spezialanzügen
möglich, Nacktbadende im Vakuum haben eine schlechte Prognose. Entscheidend
für das Design der absoluten Insel ist, daß die lose atmotopische Ausnahmesituation
der Naturinsel jetzt durch die strenge Ausnahmesituation des künstlichen
geschlossenen Atmotops nachgebaut werden muß. Das Atmen auf der natürlichen
Insel profitiert von der spontanen Klimabildung, die sich im Wechselspiel von
Meeresluft und insulaner Biosphäre vollzieht, im Inneren der absoluten Insel
gerät die Atmung in die bedingungslose Abhängigkeit von technischen
Luftversorgungssystemen, die durch die Forschung zu immer weiter ausgearbeiteter
Explizitheit vorangetrieben werden. Das Klima der absoluten Insel ist nur als
absolutes Interieur möglich, weil Inseln dieses Typs in einem für Atmer
unlebbaren Milieu navigieren. Was auf der relativen Insel Umgebungselement ist,
muß auf der absoluten Insel zu Innenraum werden. Wer dort ohne ein mitgebrachtes
Luftmilieu zu atmen versuchte, würde in kürzester Zeit ersticken, genauer
durch Vakuumembolien zu Tode kommen.“ ( ).
Hier lernen die Wohnenden auf absolute Weise, was Immunität, was Immunschutz
durch Hüllen (
).
Hier lernen die Wohnenden auf absolute Weise, was Immunität, was Immunschutz
durch Hüllen ( )
sehr explizit bedeutet.
)
sehr explizit bedeutet.
„Je weiter die Explikation voranschreitet,
desto mehr gleicht sich die Einrichtung von Wohnungen der Installation von Raumstationen
an. ( ).
Das Wohnen selbst und die Herstellung seiner Behältnisse wird zu einer Ausbuchstabierung
all der Dimensionen oder Komponenten, die auf der anthropogenen Insel in ursprünglicher
Verwachsenheit zusammengeschlossen sind - wobei sich die Zerlegung ganzheitlich
verklumpter Lebensverhältnisse und ihre rationale Neuformung vorantreiben
läßt bis an den Grenzwert einer Wiederholung der menschlichen Welt-Insel
überhaupt im Apartment für einen einzelnen Einwohner.“ (
).
Das Wohnen selbst und die Herstellung seiner Behältnisse wird zu einer Ausbuchstabierung
all der Dimensionen oder Komponenten, die auf der anthropogenen Insel in ursprünglicher
Verwachsenheit zusammengeschlossen sind - wobei sich die Zerlegung ganzheitlich
verklumpter Lebensverhältnisse und ihre rationale Neuformung vorantreiben
läßt bis an den Grenzwert einer Wiederholung der menschlichen Welt-Insel
überhaupt im Apartment für einen einzelnen Einwohner.“ ( ).
Aber nicht vergessen: Selbst ein solcher Einzel-Einwohner ist kein „Individuum“
! Auch bei seiner größten Einbildung nicht!
).
Aber nicht vergessen: Selbst ein solcher Einzel-Einwohner ist kein „Individuum“
! Auch bei seiner größten Einbildung nicht!
Wenn wir in ferner Zukunft doch noch den Sprung vom Homo sapiens sapiens über die neue Unterart Homo sapiens autisticus zu der neuen Art Homo autisticus schaffen würden, dann würden wir vielleicht (vielleicht!) Individuen sein, aber dann interessiert das wirklich überhaupt keinen mehr, denn alle anderen würden dann ja auch Individuen sein. Wir würden dann eher das sein, was wir heute noch als abnorm ansehen: Autisten!
Wenn wir ein Fazit aus unserem modernen Schaum ziehen wollen, müssen
wir zunächst feststellen, daß die abendländische Moderne
die bisher letzte und einzige Kulturmoderne ist, die es geschafft hat,
den ganzen Globus zu erfassen und demzufolge zu einer kulturübergreifenden
Größe geworden ist, die einerseits wieder zum Nomadentum tendiert
und andererseits, was wirklich schlimm ist, erstmals mit vollem Bewußtsein
die Verwüstung eines Planeten betreibt - zwar entwickelte jede Historienkultur
( )
ihre ganz spezifische Moderne, aber im Vergleich zur abendländischen
Moderne waren sie klitzekleine Modernchen und erreichten niemals den abendländischen
Einfluß auf nahezu alle Menschen, alle Lebewesen, ja beinahe alle
Existenz des Planeten. Das Paradoxon ist, daß gerade die sogenannten
Menschenrechte einen der größten Beiträge dazu leisten,
die Verwüstung des Planeten zu legitimieren und, noch schlimmer,
zu legalisieren! Bürgerliche Rechte als
moderne Rechte, zivilisierte Rechte, sollen Rechte des „Individuums“
sein - alle internationalen Rechtsformulierungen beginnen mit „one“
(entweder every one oder no one), mit dem Einen als Einzelnen,
als Selbst, als „Individuum“ - und sollen, z.B. mit Hilfe euphemistischer
Begriffe, den „Individualismus“ und den „Solipsismus“
beschönigen, können aber nicht die Frage beantworten, was eigentlich
so unteilbar, so individuell, so atomar an diesen Einzelnen sei, denn
seit Planck (
)
ihre ganz spezifische Moderne, aber im Vergleich zur abendländischen
Moderne waren sie klitzekleine Modernchen und erreichten niemals den abendländischen
Einfluß auf nahezu alle Menschen, alle Lebewesen, ja beinahe alle
Existenz des Planeten. Das Paradoxon ist, daß gerade die sogenannten
Menschenrechte einen der größten Beiträge dazu leisten,
die Verwüstung des Planeten zu legitimieren und, noch schlimmer,
zu legalisieren! Bürgerliche Rechte als
moderne Rechte, zivilisierte Rechte, sollen Rechte des „Individuums“
sein - alle internationalen Rechtsformulierungen beginnen mit „one“
(entweder every one oder no one), mit dem Einen als Einzelnen,
als Selbst, als „Individuum“ - und sollen, z.B. mit Hilfe euphemistischer
Begriffe, den „Individualismus“ und den „Solipsismus“
beschönigen, können aber nicht die Frage beantworten, was eigentlich
so unteilbar, so individuell, so atomar an diesen Einzelnen sei, denn
seit Planck ( ),
Hahn (
),
Hahn ( )
und Heisenberg (
)
und Heisenberg ( )
wissen wir definitiv: Ein Atom ist nicht unteilbar (griech. átomos).
Ein Atom ist teilbar, ein Individuum ist teilbar! Das Selbst muß
also als Teilhaber definiert werden! Wenn wir von der Symmetrie der Wohnungen
und Schonungen ausgehen müssen, dann müssen wir auch berücksichtigen,
warum der spezifische Ort für Menschen von Anfang an funktional die
Qualitäten eines technisch eingeräumten externen Uterus hat,
in dem sie auch als Geborene zeitlebens Ungeborenenprivilegien genießen,
wie vor allem Heidegger und Sloterdijk behaupten, denn für sie reproduzieren
sich die werdenden Menschen zunächst und ausschließlich in
einer Schonung; die Schonung, in der es Menschen gibt, ist also ein Effekt
einer primitiven Technik. (
)
wissen wir definitiv: Ein Atom ist nicht unteilbar (griech. átomos).
Ein Atom ist teilbar, ein Individuum ist teilbar! Das Selbst muß
also als Teilhaber definiert werden! Wenn wir von der Symmetrie der Wohnungen
und Schonungen ausgehen müssen, dann müssen wir auch berücksichtigen,
warum der spezifische Ort für Menschen von Anfang an funktional die
Qualitäten eines technisch eingeräumten externen Uterus hat,
in dem sie auch als Geborene zeitlebens Ungeborenenprivilegien genießen,
wie vor allem Heidegger und Sloterdijk behaupten, denn für sie reproduzieren
sich die werdenden Menschen zunächst und ausschließlich in
einer Schonung; die Schonung, in der es Menschen gibt, ist also ein Effekt
einer primitiven Technik. ( ).
Um die planetaren Verwüstungen und Weisen der Umweltzerstörung
(
).
Um die planetaren Verwüstungen und Weisen der Umweltzerstörung
( )
wirksam einschränken zu können, muß man unserem Planeten
und den auf ihm lebenden und wohnenden Pflanzen, Tieren und Menschen einen
Anwalt geben - nicht individuell, sondern teilhaberisch - oder zusehen,
daß die Schwachen immer mehr werden. Immer mehr schwache Menschen,
Tiere und Pflanzen sind aber immer mehr nur das Produkt jenes Egoismus,
den die individualistischen und solipsistischen Menschenrechte fördern;
auf sie kann und will der sogenannte Westen (das Abendland) nur deshalb
stolz sein, weil die meisten seiner wenigen Privilegierten ihren immer
größer werdenden privaten Reichtum durch genau diese ihre paradoxen
Menschenrechte noch effektiver schützen können. Um es deutlicher
zu sagen: Alle nicht-abendländischen Kulturen, die heute noch existieren
- die ostasiatisch-chinesische (
)
wirksam einschränken zu können, muß man unserem Planeten
und den auf ihm lebenden und wohnenden Pflanzen, Tieren und Menschen einen
Anwalt geben - nicht individuell, sondern teilhaberisch - oder zusehen,
daß die Schwachen immer mehr werden. Immer mehr schwache Menschen,
Tiere und Pflanzen sind aber immer mehr nur das Produkt jenes Egoismus,
den die individualistischen und solipsistischen Menschenrechte fördern;
auf sie kann und will der sogenannte Westen (das Abendland) nur deshalb
stolz sein, weil die meisten seiner wenigen Privilegierten ihren immer
größer werdenden privaten Reichtum durch genau diese ihre paradoxen
Menschenrechte noch effektiver schützen können. Um es deutlicher
zu sagen: Alle nicht-abendländischen Kulturen, die heute noch existieren
- die ostasiatisch-chinesische ( ),
die südasiatisch-indische (
),
die südasiatisch-indische ( ),
die persisch-arabische (
),
die persisch-arabische ( )
-, sind schon vor langer Zeit zu Zivilisationen, also zu zivilisierten
Kulturen geworden und gehen moralisch und rechtlich nicht vom Individuum
aus, sondern von der Familie, der Gruppe, der Sippe, der Gemeinschaft
. Zu dieser Tradition gehören 60-70% der Weltbevölkerung, und
weil auch die primitiven Kulturen nicht vom Individualismus ausgehen,
sind es sogar über 80% der Weltbevölkerung (
)
-, sind schon vor langer Zeit zu Zivilisationen, also zu zivilisierten
Kulturen geworden und gehen moralisch und rechtlich nicht vom Individuum
aus, sondern von der Familie, der Gruppe, der Sippe, der Gemeinschaft
. Zu dieser Tradition gehören 60-70% der Weltbevölkerung, und
weil auch die primitiven Kulturen nicht vom Individualismus ausgehen,
sind es sogar über 80% der Weltbevölkerung ( ).
Die können wir Westler nicht einfach verleugnen; wir müssen
sie, ihre Bräuche und Traditionen zumindest respektieren. Da gegenwärtig
auch noch die Demographie für die abendländische Kultur ungünstig
und für den nicht-abendländischen Rest der Welt günstig
ist, könnte es nur noch eine Frage der Zeit sein, wann wir uns mit
unseren eigenen Waffen geschlagen haben werden.
).
Die können wir Westler nicht einfach verleugnen; wir müssen
sie, ihre Bräuche und Traditionen zumindest respektieren. Da gegenwärtig
auch noch die Demographie für die abendländische Kultur ungünstig
und für den nicht-abendländischen Rest der Welt günstig
ist, könnte es nur noch eine Frage der Zeit sein, wann wir uns mit
unseren eigenen Waffen geschlagen haben werden.
Weil wir und vor
allem unsere Privilegierten den Egoismus, den Kern des Kapitalismus als einen
unteilbaren Kern auch in Zukunft verteidigen (lassen) werden und auch wegen der
Wahrscheinlichkeit, daß unsere vom atomaren Zustand zum nur noch mathematisch
feststellbaren unendlich kleinen Pünktchen verrechtlichten Individuen in
ihrem Human-Vakuum isoliert geblieben sein werden, wird es trotz oder eher sogar
wegen unserer Kriegsmüdigkeit sehr wahrscheinlich zu einer Entscheidung gekommen
sein über unsere Kriege gegen das, was Oswald Spengler das zwischen „weißer
Weltrevolution“ ( )
und „farbiger Weltrevolution“ (
)
und „farbiger Weltrevolution“ ( )
zukünftig mögliche Bündnis (
)
zukünftig mögliche Bündnis ( )
nannte und wir heute (viktimologisch, als seien nur wir Opfer und deshalb als
Täter entschuldigt
)
nannte und wir heute (viktimologisch, als seien nur wir Opfer und deshalb als
Täter entschuldigt )
den „Globalen Terrorismus“ (
)
den „Globalen Terrorismus“ ( )
nennen, obwohl wir ihn eigentlich, nämlich von unserer aktiven Seite her,
Globalismus-Terror nennen müßten, denn diese Globalismus-Phase (Befruchtung
oder Cäsarismus
)
nennen, obwohl wir ihn eigentlich, nämlich von unserer aktiven Seite her,
Globalismus-Terror nennen müßten, denn diese Globalismus-Phase (Befruchtung
oder Cäsarismus )
ist eine Phase der abendländischen Kultur - sie geht also aktiv von uns aus,
vom Westen, vom Abendland. Weil die bösartigen Reaktionen darauf eher zunehmen
als abnehmen und die zunehmenden Gegenreaktionen darauf eher bösartig als
gutartig sein werden, wird auch immer mehr die nur eine Seite des Individualismus
offenkundiger werden. Der Individualismus ist nur von einer Seite her begründet
und auch deshalb schon vom Ansatz her falsch. Der Ansatz hätte nicht individuus
= unteilbar lauten dürfen, der Ansatz hätte dividuus = teilbar
lauten müssen. Man hätte nicht vom Individuum, sondern vom Dividuum
sprechen müssen.
)
ist eine Phase der abendländischen Kultur - sie geht also aktiv von uns aus,
vom Westen, vom Abendland. Weil die bösartigen Reaktionen darauf eher zunehmen
als abnehmen und die zunehmenden Gegenreaktionen darauf eher bösartig als
gutartig sein werden, wird auch immer mehr die nur eine Seite des Individualismus
offenkundiger werden. Der Individualismus ist nur von einer Seite her begründet
und auch deshalb schon vom Ansatz her falsch. Der Ansatz hätte nicht individuus
= unteilbar lauten dürfen, der Ansatz hätte dividuus = teilbar
lauten müssen. Man hätte nicht vom Individuum, sondern vom Dividuum
sprechen müssen. 
In
unserem modernen Recht ist also schon der Ansatz falsch, weil er vom Individuum,
von einem unsinnigen Begriff ausgeht. Auch spricht unser modernes Recht nicht
mehr von der Gemeinschaft, sondern allenfalls von der Gesellschaft, von einem
ebenso unsinnigen Begriff. Individuum und Gesellschaft - unzählige Leute
haben sich damit beschäftigt - sind moderne bzw. zivilisierte Begriffe, die
davon künden, daß man zur Kultur nicht mehr fähig ist. Die Kultur
kann nur noch als Zivilisation verstanden werden, obwohl fast niemand wirklich
begreift, was das bedeutet. Da aber jede Kultur, sobald sie erwachsen und reif
geworden ist, zur Zivilkultur (Zivilisation bezeichnet also eigentlich nur den
Prozeß einer zivilen Kultur) geworden ist, so ist dadurch auch unvermeidlich
geworden, daß mit ihr z.B. diese merkwürdigen Umformulierungen einhergehen:
das Selbst wird zum Individuum verklärt, die Gemeinschaft wird zur Gesellschaft
degradiert, die traditionelle Sitte wird zur allmenschlichen Moral verklärt,
ohne die riesige Mehrheit zu berücksichtigen, die darin die Privilegien der
wenigen Reichen erst richtig erkennt. Privilegierte Westler reden vom politisch-militärisch
notwendigen „präventiven Erstschlag“ - eine Viktimologie (!), denn
die vorausgesetzte und suggerierte Opferrolle soll die Täterrolle entschuldigen,
legitimieren, ja sogar legalisieren. ( ).
Privilegierte Westler predigen die „soziale Gerechtigkeit“ - eine Tautologie
(!), denn in dem Wort Gerechtigkeit ist das Soziale immer schon enthalten. Privilegierte
Westler sagen „Bürgerinnen und Bürger“, „Wählerinnen
und Wähler“ u.s.w. - eine Tautologie (!), denn in dem Pluralmorphem
er ist das Weibliche immer schon enthalten. Diese Beispiele ließen
sich bis ins Unendliche fortführen: von der priviligierten Seite her sollen
sie entschuldigen, täuschen und ablenken, von der lobbyistischen Seite her
sollen sie den Aufstieg ins Privilegierte ermöglichen, aber die Konsequenz
ist, daß die wirklich Betroffenen nur noch mehr ins ohnmächtige Abseits
verdrängt werden.
).
Privilegierte Westler predigen die „soziale Gerechtigkeit“ - eine Tautologie
(!), denn in dem Wort Gerechtigkeit ist das Soziale immer schon enthalten. Privilegierte
Westler sagen „Bürgerinnen und Bürger“, „Wählerinnen
und Wähler“ u.s.w. - eine Tautologie (!), denn in dem Pluralmorphem
er ist das Weibliche immer schon enthalten. Diese Beispiele ließen
sich bis ins Unendliche fortführen: von der priviligierten Seite her sollen
sie entschuldigen, täuschen und ablenken, von der lobbyistischen Seite her
sollen sie den Aufstieg ins Privilegierte ermöglichen, aber die Konsequenz
ist, daß die wirklich Betroffenen nur noch mehr ins ohnmächtige Abseits
verdrängt werden.
In der modernen
Weltpolitik rückt der Schlußverkauf immer näher: wer hier noch
aktiv sein will, muß sich „anstellen“, soll heißen: nicht
großartig anstrengen, aber immer viktimologisch argumentieren ( )
- die Privilegierten (Regierenden) und die Lobbyisten machen es ja vor -, so sprechen
und tun, als ob man immer nur das Opfer gewesen sei, um zumindest den Sprung in
die Lobby zu schaffen, immer näher an die durch die Opferrolle verheimlichte,
entschuldigte, legitimierte und legalisierte Täterrolle, die große
Politik, zu kommen. Dies hat enorme Konsequenzen: Mitbestimmung
ist nicht mehr eine Sache der Mehrheit, des Volkes, also der Demokratie, sondern
einer Minderheit, die mit jeder Tradition zu brechen bereit ist, die Zugeständnisse
an fremde Minderheiten machen muß, weil die Viktimologie deren Gemeinsamkeit
ist, zum Bündnis oder zumindest zu einer (un)heimlichen Verschwörung
zwingt, worin Hierarchie und Machtverhältnisse immer wieder neu verhandelt
und ausgetragen werden müssen; dies alles geschieht auf Kosten der Mehrheit,
des Volkes, der Demokratie, und fördert die Diktatur von Meinungen und Tugenden,
wobei der große Vorteil der Privilegierten und u.a. darin besteht, weiterhin
von Demokratie sprechen und von Plutokratie schweigen zu können, obwohl in
Wirklichkeit über beiden die Zeusiokratie (
)
- die Privilegierten (Regierenden) und die Lobbyisten machen es ja vor -, so sprechen
und tun, als ob man immer nur das Opfer gewesen sei, um zumindest den Sprung in
die Lobby zu schaffen, immer näher an die durch die Opferrolle verheimlichte,
entschuldigte, legitimierte und legalisierte Täterrolle, die große
Politik, zu kommen. Dies hat enorme Konsequenzen: Mitbestimmung
ist nicht mehr eine Sache der Mehrheit, des Volkes, also der Demokratie, sondern
einer Minderheit, die mit jeder Tradition zu brechen bereit ist, die Zugeständnisse
an fremde Minderheiten machen muß, weil die Viktimologie deren Gemeinsamkeit
ist, zum Bündnis oder zumindest zu einer (un)heimlichen Verschwörung
zwingt, worin Hierarchie und Machtverhältnisse immer wieder neu verhandelt
und ausgetragen werden müssen; dies alles geschieht auf Kosten der Mehrheit,
des Volkes, der Demokratie, und fördert die Diktatur von Meinungen und Tugenden,
wobei der große Vorteil der Privilegierten und u.a. darin besteht, weiterhin
von Demokratie sprechen und von Plutokratie schweigen zu können, obwohl in
Wirklichkeit über beiden die Zeusiokratie ( )
thront: Befruchtung oder Cäsarismus (
)
thront: Befruchtung oder Cäsarismus ( ),
das ist die Frage, und die beantworten Privilegierte zugunsten der Befruchtung,
weil ja im Hintergrund der Cäsarismus operiert. Was nützt z.B.
der Slogan Demokratie und Reichtum für alle, wenn dahinter nur die
Privatdemokratie und der Privatreichtum der wenigen Privilegierten operiert; was
nützt der Mehrheit eine Meinungsfreiheit, wenn sie in Wirklichkeit nur die
Meinungen von ca. 100 Reichen hören oder sonstwie zur Kenntnis nehmen darf.
Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und überhaupt Medienfreiheit: in einer Mediokratie
die Freiheit dieser ca. 100 Reichen; nur sie werden gehört oder sonstwie
zur Kenntnis genommen, während der ausgegrenzte Rest das Freiheitsrecht zwar
ausüben darf und sogar soll, aber effektiv nicht kann, weil er nicht gehört
oder sonstwie zur Kenntnis genommen wird. Der individuelle Horror an dieser Ausgrenzung
ist die Unmöglichkeit des Teilhabens, z.B. an den Bestimmungen und Entscheidungen
über das Gemeinsame, das Tabu, Dividuum oder Teilhaber sein zu dürfen,
das Totem, Individuum oder Nicht-Teilhaber sein zu müssen - im Human-Vakuum
der nur noch mathematisch feststellbaren unendlich kleinen Pünktchen. (
),
das ist die Frage, und die beantworten Privilegierte zugunsten der Befruchtung,
weil ja im Hintergrund der Cäsarismus operiert. Was nützt z.B.
der Slogan Demokratie und Reichtum für alle, wenn dahinter nur die
Privatdemokratie und der Privatreichtum der wenigen Privilegierten operiert; was
nützt der Mehrheit eine Meinungsfreiheit, wenn sie in Wirklichkeit nur die
Meinungen von ca. 100 Reichen hören oder sonstwie zur Kenntnis nehmen darf.
Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und überhaupt Medienfreiheit: in einer Mediokratie
die Freiheit dieser ca. 100 Reichen; nur sie werden gehört oder sonstwie
zur Kenntnis genommen, während der ausgegrenzte Rest das Freiheitsrecht zwar
ausüben darf und sogar soll, aber effektiv nicht kann, weil er nicht gehört
oder sonstwie zur Kenntnis genommen wird. Der individuelle Horror an dieser Ausgrenzung
ist die Unmöglichkeit des Teilhabens, z.B. an den Bestimmungen und Entscheidungen
über das Gemeinsame, das Tabu, Dividuum oder Teilhaber sein zu dürfen,
das Totem, Individuum oder Nicht-Teilhaber sein zu müssen - im Human-Vakuum
der nur noch mathematisch feststellbaren unendlich kleinen Pünktchen. ( ).
Wer den Individualismus will, will die Leichtigkeit des Seins, die unerträglich
nur werden kann, weil der zum Individuum (v)erklärte Einzelne dort zu schweben
hat, wo keiner ist und nur das leichte Nichts noch belastet - langweilig.
).
Wer den Individualismus will, will die Leichtigkeit des Seins, die unerträglich
nur werden kann, weil der zum Individuum (v)erklärte Einzelne dort zu schweben
hat, wo keiner ist und nur das leichte Nichts noch belastet - langweilig.
 |
 |
Wie
stark das Ausmaß einer drohenden Umweltkatastrophe werden kann, zeigt gegenwärtig
die Arktis sehr deutlich: „Inzwischen befürchten
Klimaforscher, daß der sogenannte Umkippunkt erreicht ist, von dem an im
Sommer mehr Eis abtaut als im Winter nachwächst. ( ).
Hinzu kommt, daß das Meereis nicht nur in der Flächenausdehnung abnimmt,
sondern auch dünner wird. In Zusammenarbeit mit der Universität Bremen
haben wir auf Ellesmere Island die bodennahen Ozonwerte gemessen. Sie sind Mosaiksteinchen
in dem riesigen Puzzle des Klimageschehens und helfen uns, die Zusammenhänge
zu verstehen. Insgesamt sind die Signale alarmierend: Wir können die Folgen
des Klimawandels nicht mehr übersehen (
).
Hinzu kommt, daß das Meereis nicht nur in der Flächenausdehnung abnimmt,
sondern auch dünner wird. In Zusammenarbeit mit der Universität Bremen
haben wir auf Ellesmere Island die bodennahen Ozonwerte gemessen. Sie sind Mosaiksteinchen
in dem riesigen Puzzle des Klimageschehens und helfen uns, die Zusammenhänge
zu verstehen. Insgesamt sind die Signale alarmierend: Wir können die Folgen
des Klimawandels nicht mehr übersehen ( ).
Auch wenn einige Unternehmen bereits frohlocken, weil die Bodenschätze in
Nordpolnähe endlich in Griffweite sind und ein weitgehend eisfreies Polarmeer
neue Schiffahrtsrouten möglich macht - in dieser Entwicklung wird es keine
Gewinner geben. Der frühere Weltbank-Chefökonom Nicholas Stern beziffert
die weltweiten Folgekosten des Klimawandels auf eine schier unglaubliche Summe:
5,5 Billionen Euro.“ (Arved Fuchs, Das Eis schmilzt unaufhörlich,
in: National Geographic Deutschland, Januar 2007, S. 131). Die Thesen von
Nicholas Stern sind jedoch mit einem großen Fragezeichen zu versehen, weil
Stern (a) berühmt werden will, (b)
einen Nobelpreis haben will, (c) in seinem Bericht
(auch „Stern-Bericht“ genannt) extrem pessimistische Szenarien beschreibt,
die Schäden viel zu hoch und die Kosten, z.B. für die Emissionsreduktion,
viel zu niedrig ansetzt, um die entsprechenden Effekte in Medien, Politik und
Gesellschaft zu erzielen, die er für seine persönlichen Vorteile und
Erfolge - siehe (a) und (b)
- braucht.
).
Auch wenn einige Unternehmen bereits frohlocken, weil die Bodenschätze in
Nordpolnähe endlich in Griffweite sind und ein weitgehend eisfreies Polarmeer
neue Schiffahrtsrouten möglich macht - in dieser Entwicklung wird es keine
Gewinner geben. Der frühere Weltbank-Chefökonom Nicholas Stern beziffert
die weltweiten Folgekosten des Klimawandels auf eine schier unglaubliche Summe:
5,5 Billionen Euro.“ (Arved Fuchs, Das Eis schmilzt unaufhörlich,
in: National Geographic Deutschland, Januar 2007, S. 131). Die Thesen von
Nicholas Stern sind jedoch mit einem großen Fragezeichen zu versehen, weil
Stern (a) berühmt werden will, (b)
einen Nobelpreis haben will, (c) in seinem Bericht
(auch „Stern-Bericht“ genannt) extrem pessimistische Szenarien beschreibt,
die Schäden viel zu hoch und die Kosten, z.B. für die Emissionsreduktion,
viel zu niedrig ansetzt, um die entsprechenden Effekte in Medien, Politik und
Gesellschaft zu erzielen, die er für seine persönlichen Vorteile und
Erfolge - siehe (a) und (b)
- braucht. 
 |
Aber wie weit sollen Zynismus und Mißbrauch von Umwelt und Begriff „Umwelt“ noch gehen? Wann endlich werden die Naturausbeuter, die Pflanzenmörder und Tiermörder tatsächlich und wirklich bestraft? Zuerst einmal müssen die Politiker endlich begreifen, daß im Gegenteil zu den „grünen“ Träumereien der sogenannte gesellschaftliche und ökonomische Fortschritt geradezu in ihrer Verletzung liegt. Pflanzen und Tiere werden faktisch erst dann geschützt, wenn für sie ein geldliches Verwertungsinteresse besteht. Es werden z.B. bestimmte abgeholzte Pflanzen, weil sie als Hölzer genutzt werden, vor ihrer Ausrottung geschützt; es werden z.B. bestimmte Tiere, weil ihre Pelze getragen werden, vor ihrer Ausrottung geschützt. Mit anderen Worten: Schutz erfahren de facto nur solche Lebewesen, die wegen ihres wirtschaftlichen Nutzens benötigt werden.
 |
Bedeutsamer als die politisch begründeten juristischen Gesetze, weil sie fast alle auf micheliger Träumerei beruhen, sind also die biologisch begründeten sozio-ökonomischen Fakten. Und das müssen auch die Politiker und Juristen endlich begreifen, bevor sie mit ihrer nächsten micheligen Träumerei wieder nur den Verbrechern dienen. Die von den Politikern und Juristen formulierten Gesetze, vor allem die fälschlicherweise oder mit viel Zynismus „Menschenrechte“ genannten „Individualrechte“ dienen den ohnehin schon Mächtigen und den Verbrechern - oft sind die beiden Wörter „Mächtige“ und „Verbrecher“ sogar mit Recht wie Synonyme zu verwenden. Wir brauchen Gesetze und Regeln, aber andere als die, die heute noch gelten. Diese müssen alle umformuliert werden. Man muß zunächst einmal wissen, was und wie der Mensch wirklich ist. Immer wieder von jenem Menschenbild auszugehen, das der Wirklichkeit nicht entspricht, hat immer wieder nur fatale katastrophale Folgen.
|
Jährlich verschwinden schätzungsweise bis zu 35000 Arten für immer von der Erde. Die Geschwindigkeit des globalen Artenverlustes liegt ca. um den Faktor 1000-10000 über der natürlichen Aussterberate von ca. 10 Arten pro Jahr (bei z.B. der Klasse der Säugetiere: 1 Art in 400 Jahren). Vom Aussterben bedrohte Arten stehen seit Beginn der 1960er Jahre in Roten Listen. Ein Auszug daraus:
| R o t e L i s t e b e d r o h t e r A r t e n (Stand: 2004) | |||||
| „Gruppe“ | Zahl beschriebener Arten | Zahl bewerteter Arten | Anteil
bedrohter Arten an beschriebenen (bewerteten) Arten | „Rang“ | |
| Wirbeltiere | |||||
| Säugetiere | 5416 | 4863 | 20% (23%) | 2 (9) | |
| Vögel | 9917 | 9917 | 12% (12%) | 3 (10) | |
| Reptilien | 8163 | 499 | 4% (61%) | 4 (4) | |
| Amphibien | 5743 | 5743 | 31% (31%) | 1 (8) | |
| Fische | 28500 | 1721 | 3% (46%) | 5 (6) | |
| Zwischensumme | 57739 | 22733 | 9% (23%) | ||
| Wirbellose | |||||
| Insekten | 990000 | 771 | 0,06% (73%) | 9 (2) | |
| Weichtiere | 110000 | 2163 | 1% (45%) | 7 (7) | |
| Krustentiere | 60000 | 496 | 1% (85%) | 7 (1) | |
| Andere | 260000 | 55 | 0,02% (55%) | 10 (5) | |
| Zwischensumme | 1420000 | 3382 | 0,17% (57%) | ||
| PFLANZEN | 300000 | 11826 | 2,7% (70%) | 6 (3) | |
| Summe | 1777739 | 38046 | 1% (41%) | ||
Zu den in dem Jahr 2004 beschriebenen und wissenschaftlich benannten fast 2 Millionen Arten kommen jährlich rund 15000 Arten hinzu. Laut Wissensstand aus dem Jahr 2004 scheint die Klasse der Insekten mit 990000 Arten am vielfältigsten zu sein, gefolgt von dem Reich der Pflanzen mit 300000 Arten. Die Vielfalt der Abteilung der Pilze und die Vielfalt des Stammes der Weichtiere sowie die Vielfalt der Ordnung der Spinnen sind jeweils (jeweils!) fast doppelt so groß wie die Vielfalt des Unterstammes der Wirbeltiere (ca. 58000 bekannte Arten - laut Wissensstand aus dem Jahr 2004). Bekannt ist jedoch nur ein Bruchteil aller Arten. Schätzungen für die Gesamtzahl liegen in der Größenordnung von 10 bis 100 Millionen (also 5mal bis 50mal mehr als die aus dem Jahr 2004 bekannten Arten [2 Millionen {d.h. 20% von 10 Millionen bzw. 2% von 100 Millionen}]) und werden durch die Zahl der unbekannten Insektenarten dominiert. Die globale Vielfalt an pflanzlichen und tierischen Lebewesen ist sehr inhomogen verteilt. So beherbergen z.B. die feucht-warmen tropischen Regenwälder, obwohl sie nur 7% der Landfläche bedecken, nahezu 90% der an Land vorkommenden Artenvielfalt.
 Von Lösungen für bedrohte Arten soll aber schweigen, wer von
Lösungen für bedrohte Völker oder Rassen nichts wissen
will!
Von Lösungen für bedrohte Arten soll aber schweigen, wer von
Lösungen für bedrohte Völker oder Rassen nichts wissen
will! 
Biologische Vielfalt und Biodervisität gehen als Begriffe über den Begriff der Artenvielfalt (Verschiedenheit aller Pflanzen- Tierarten) hinaus und erfassen zusätzlich die Vielfalt der Ökosysteme und der Sorten jeder einzelnen Spezies. Das Ziel des Erhalts der biologischen Vielfalt folgt zum einen aus der Anerkennung ihres Eigenwerts, zum anderen gründet es auf der Erkenntnis, daß eine Vielfalt der Erscheinungsformen Grundvoraussetzung für die Stabilität der Ökosysteme ist, von deren Leistungen auch der Mensch abhängt. Nicht zuletzt stellt die Biodervisität eine ökonomische Ressource dar. Der Marktwert aller biogenen Medikamente z.B. wird auf 75-150 Mio US-$ p.a. geschätzt. Die Gesundheitsversorgung von drei Vierteln der Weltbevölkerung stützt sich direkt auf natürliche Heilmittel. Trotz des Wissens um ihre zentrale Bedeutung setzt sich der Verlust an biologischer Vielfalt mit großer Geschwindigkeit fort.
Zu den wichtigsten Ursachen für den Verlust biologischer Vielfalt gehören:Am 30.03.2005 wurde die bisher größte und umfassendste Untersuchung des Zustands der globalen Umwelt - das Millenium Ecosystem Assessment (MEA) - veröffentlicht. Vier Jahre lang hatten fast 1400 Wissenschaftler aus 95 Nationen unter dem Dach der UNO den Zustand von Ökosystemen analysiert. Die Ergebnisse des insgesamt 2500 Seiten langen Berichts sind alarmierend: In den 40 Jahren von 1960 bis 2000 haben Menschen die Ökosysteme schneller und tiefgreifender verändert als jemals zuvor! Die Beeinträchtigung der Umwelt - insbesondere in den Entwicklungsländern, d.h. in der „3. Welt“ und größtenteils auch in der „2. Welt“ - ist jedoch so gravierend, daß künftige Generationen wohl notwendigerweise andere Wirtschafts- und Konsumstile entwickeln werden (müssen!), falls solche Veränderungen nicht durch andere, - nämlich von außen kommende - Einflüsse (z.B. Katastrophen u.ä.) erzwungen und auch nicht mit Hilfe von Wissenschaft und Technik (z.B. „Ökotechnik“ u.ä.) überflüssig bzw. unnötig gemacht werden.
Der MEA-Bericht von 2005 präsentiert u.a. folgende Fakten:| – | 20% der Korallenriffe und 35% der Mangrovengebiete wurden in den letzten Jahrzehnten zerstört. Weitere 20% der Korallenriffe sind akut von der Zerstörung bedroht. |
| – | Die
Wasserentnahme aus Flüssen und Seen hat sich seit 1960 verdoppelt, die Wassermenge
in künstlichen Reservoiren vervierfacht. Mein Kommentar: Bleibt abzuwarten, ob Wissenschaft und Technik für dieses Problem eine befriedigende Lösung finden werden. Falls nicht, werden Kriege um Trinkwasser eine von vielen schrecklichen Folgen sein. |
| – | Das
Artensterben hat sehr stark zugenommen, und der Anteil bedrohter Arten ist extrem
gestiegen (vgl. Rote
Liste). |
| – | Der
Holzeinschlag für die Produktion von Papier und Pappe hat sich seit 1960
verdreifacht. Mein Kommentar: Entscheidend ist hier tatsächlich die Menge, denn Holzeinschlag dient in dem Fall dann der Arterhaltung, wenn genügend Wald wieder aufgeforstet wird. So wie z.B. eine Kuh vor der Schlachtung oder sogar Ausrottung geschützt wird, so lange sie Milch gibt, so können an sich auch alle Pflanzenarten vor dem Aussterben gerettet werden. Voraussetzung für den Schutz von Pflanzen und Tieren ist deren Eingliederung in unser „Haus“ ( |
| – | 25%
der kommerziell genutzten Fischbestände in den Ozeanen des Planeten Erde
sind übernutzt. Der Fischfang in den Meeren unseres Globus ist schon seit
längerem rückläufig. Mein Kommentar: Entscheidend ist auch hier tatsächlich die Menge, denn auch der Fischfang dient ja im Grunde dann der Arterhaltung, wenn genügend Fische wieder aufgezüchtet werden. Leider kann aber die Fischzucht trotz des Wachstums ihrer Fischanzahl die immer stärker steigende „Nachfrage“ nicht befriedigen. Die „Fisch-Nachfrage“ ist gegenwärtig noch zu hoch. Die Empfehlung zur Lösung lautet wie beim Problem durch Holzeinschlag ( |
Bevölkerung
und Umwelt korrelieren miteinander wie Wohnen und Schonen. Bevölkerungsprobleme
und Umweltprobleme sind wie Wohnprobleme und Schonprobleme immer im Zusammenhang
zu sehen. Also werden auch die globalen Umweltprobleme erst dann „gelöst“
werden können, wenn die Geburtenrate der Menschheit auf die bestandserhaltende
Rate (2,13 Kinder pro Frau) gesunken sein wird, nämlich - dies ist wichtig
-, indem die Geburtenrate der „3. Welt“ (und zum Teil auch der „2.
Welt“) auf 2,13 Kinder pro Frau gesunken, aber die Geburtenrate der
„1. Welt“ (und zum Teil auch der „ 2. Welt“) auf 2,13 Kinder
pro Frau gestiegen sein wird (würde [![]() ];
der Konjunktiv muß sein, denn wir können gar nicht genau wissen, ob
es sich so ereignen wird). Doch nur so wird es gehen, denn sonst wird es nur noch
viel mehr Probleme geben.
];
der Konjunktiv muß sein, denn wir können gar nicht genau wissen, ob
es sich so ereignen wird). Doch nur so wird es gehen, denn sonst wird es nur noch
viel mehr Probleme geben.
 Wer von Lösungen der Bevölkerungsprobleme nichts wissen will, soll von
Lösungen der Umweltprobleme schweigen!
Wer von Lösungen der Bevölkerungsprobleme nichts wissen will, soll von
Lösungen der Umweltprobleme schweigen! 
 |
Gedanken-Experiment:
Schrumpfung der „Opfer“ (Pflanzen und Tiere) und Schrumpfung
der „Täter“ (Menschen, vor allem aus den reichen Ländern,
also aus dem Westen [Abendland] und seinen Ablegern) korrelieren miteinander.
Das Schrumpfen der „Opfer“ ist stärker beschleunigt als
das Schrumpfen der „Täter“, denn das Schrumpfen der Bevölkerungen
aus dem Westen und seinen Ablegern steckt ja noch in seinen Anfängen.
Trotzdem ist der Zusammenhang deutlich erkennbar. Zwar gehören zu
den „Tätern“ auch Menschen der „2. Welt“ und
„3. Welt“, doch deren Verhaltensweisen sind ja lediglich die
Folgen aus der Übernahme von Technik, Wissenschaft und Wirtschaftsweise
der „1. Welt“, also des Westens (Abendlandes). Hieraus folgt,
daß Umweltschutz bzw. ehrliche Umweltpolitik nur betreiben kann,
wer die Politik der „1. Welt“ bekämpft; und weil dies wiederum
mit Notwendigkeit an der demographischen Entwicklung deutlich ablesbar
ist, sind allen Politikern mit ihren Lügen alle Wege zur Ausrede
versperrt! Erst wenn die Bevölkerungen der „1. Welt“ wieder
wachsen werden, werden auch die Arten der „Opfer“ wieder wachsen
können. Und die Bevölkerungen der „1. Welt“ werden
erst dann wieder wachsen können, wenn die „1. Welt“ die
„Kehre“ ihrer Umweltpolitik vollzogen hat. Davon ist sie gegenwärtig
aber leider noch meilenweit entfernt. Und dazu kommt, daß die „2.
Welt“ und die „3. Welt“ die heutige Umweltpolitik der „1.
Welt“ übernehmen und auch deshalb die bisherigen Umweltzerstörungen
noch überbieten und beschleunigen werden, weil die abendländisch
dominierte Organisation namens „UNO“ (![]() ),
die angeblich eine „Weltgemeinschaft“ sein soll und in
Wirklichkeit von einer solchen noch meilenweit entfernt ist, über
die „Menschenrechte“ genannten „Individualrechte“
die Umweltzerstörungen ausdrücklich erlaubt, ja sogar fordert
(!). Daraus folgt: Welt und Umwelt sind nur zu schonen, wenn die heutige
westlich (abendländisch) dominierte Politik bekämpft wird, denn
dadurch wird letztendlich auch der ebenfalls immer mehr auf Schonung angewiesene
Westen (das Abendland) gerettet.
),
die angeblich eine „Weltgemeinschaft“ sein soll und in
Wirklichkeit von einer solchen noch meilenweit entfernt ist, über
die „Menschenrechte“ genannten „Individualrechte“
die Umweltzerstörungen ausdrücklich erlaubt, ja sogar fordert
(!). Daraus folgt: Welt und Umwelt sind nur zu schonen, wenn die heutige
westlich (abendländisch) dominierte Politik bekämpft wird, denn
dadurch wird letztendlich auch der ebenfalls immer mehr auf Schonung angewiesene
Westen (das Abendland) gerettet.
 |
Einen
sehr wichtigen Beitrag zum Erhalt der biologischen Vielfalt (![]() )
liefern nationale und internationale Schutzgebiete, in denen menschliche Aktivitäten
(z.B. in Land- und Forstwirtschaft u.a.) Einschränkungen unterworfen werden.
Neue Forschungen belegen, daß diese Schutzgebietssysteme - entgegen häufig
geübter Kritik - sehr effizient sind. Im Gegensatz zu den umgebenden Gebieten
können z.B. Rodungen sowie andere Nutzungsänderungen in Schutzgebieten
meist vermieden und damit Lebensräume für Pflanzen- und Tierarten erhalten
werden. Die weltweite Zahl der Schutzgebiete hat im Jahr 2003 die Marke von 100000
überschritten. Ende des Jahres 2004 betrug die weltweit unter Schutz stehenden
Fläche (Land und Meer) 19,5 Mio. km² (
)
liefern nationale und internationale Schutzgebiete, in denen menschliche Aktivitäten
(z.B. in Land- und Forstwirtschaft u.a.) Einschränkungen unterworfen werden.
Neue Forschungen belegen, daß diese Schutzgebietssysteme - entgegen häufig
geübter Kritik - sehr effizient sind. Im Gegensatz zu den umgebenden Gebieten
können z.B. Rodungen sowie andere Nutzungsänderungen in Schutzgebieten
meist vermieden und damit Lebensräume für Pflanzen- und Tierarten erhalten
werden. Die weltweite Zahl der Schutzgebiete hat im Jahr 2003 die Marke von 100000
überschritten. Ende des Jahres 2004 betrug die weltweit unter Schutz stehenden
Fläche (Land und Meer) 19,5 Mio. km² (![]() ).
).
Der Naturschutzgedanke stammt aus der Romantik
( ).
).
|
Reichsnaturschutzgesetz
vom 26. Juni 1935
Briefmarke
von 1969 zum
|
Einer der entscheidenden Bahnbrecher des Naturschutzes war der Naturforscher
und Forstwissenschaftler Johann Matthäus Bechstein (1757-1822 ).
Als einer der ersten Akte des Naturschutzes kann der im Jahre 1803 erfolgte
Schutz des Bamberger Hains angesehen werden. 1836 wurde ein Teil des Drachenfelsens
von der preußischen Regierung aufgekauft, um einen weiteren Abbau
des Berges zu verhindern; dies wird oft als Einrichtung des ersten Naturschutzgebietes
angesehen (formale Unter-Schutz-Stellung aber erst 1922), obwohl es ja
bereits vorher anderenorts zu lokalen Schutzmaßnahmen kam, wie schon
gesagt (z.B. 1803 die des Bamberger Hains). 1852 wurde die Teufelsmauer
im Harz als Schutzgebiet ausgewiesen. 1875 wurde das Schutzwaldgesetz
erlassen, wurde der Deutsche Verein zum Schutz der Vogelwelt gegründet,
und 1876 wurde ein erster Entwurf für ein Reichsvogelschutzgesetz
erarbeitet; es trat 1888 in Kraft. Den Naturschutz als Begriff kreierte
wahrscheinlich erst Ernst Rudorff (1840-1916
).
Als einer der ersten Akte des Naturschutzes kann der im Jahre 1803 erfolgte
Schutz des Bamberger Hains angesehen werden. 1836 wurde ein Teil des Drachenfelsens
von der preußischen Regierung aufgekauft, um einen weiteren Abbau
des Berges zu verhindern; dies wird oft als Einrichtung des ersten Naturschutzgebietes
angesehen (formale Unter-Schutz-Stellung aber erst 1922), obwohl es ja
bereits vorher anderenorts zu lokalen Schutzmaßnahmen kam, wie schon
gesagt (z.B. 1803 die des Bamberger Hains). 1852 wurde die Teufelsmauer
im Harz als Schutzgebiet ausgewiesen. 1875 wurde das Schutzwaldgesetz
erlassen, wurde der Deutsche Verein zum Schutz der Vogelwelt gegründet,
und 1876 wurde ein erster Entwurf für ein Reichsvogelschutzgesetz
erarbeitet; es trat 1888 in Kraft. Den Naturschutz als Begriff kreierte
wahrscheinlich erst Ernst Rudorff (1840-1916 )
mit seinem Tagebuch-Eintrag vom 9. November 1888: „einen wichtigen
Brief geschrieben ... über den Naturschutz.“ 1899 gründete
Lina Hähnle (1851-1941) den Deutschen Bund für Vogelschutz,
heute bekannt unter dem Namen Naturschutzbund Deutschland. 1902 trat das
erstes Landschaftsschutzgesetz für Preußen in Kraft. Für
ganz Deutschland wurde 1904 der Bund für Heimatschutz gegründet.
1906 wurde eine staatliche Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen
unter der Leitung von Hugo Wilhelm Conwentz (1855-1922
)
mit seinem Tagebuch-Eintrag vom 9. November 1888: „einen wichtigen
Brief geschrieben ... über den Naturschutz.“ 1899 gründete
Lina Hähnle (1851-1941) den Deutschen Bund für Vogelschutz,
heute bekannt unter dem Namen Naturschutzbund Deutschland. 1902 trat das
erstes Landschaftsschutzgesetz für Preußen in Kraft. Für
ganz Deutschland wurde 1904 der Bund für Heimatschutz gegründet.
1906 wurde eine staatliche Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen
unter der Leitung von Hugo Wilhelm Conwentz (1855-1922 )
eingerichtet. Der Naturschutzpark Lüneburger Heide entand 1910 in
privater Initiative (Verein Naturschutzpark e.V.; die staatliche Ausweisung
als Naturschutzgebiet erfolgte erst 1921). 1912 wurde der Pflanzenschonbezirk
Berchtesgadener Alpen fertiggestellt - als Vorläufer des heutigen
Nationalpark Berchtesgaden. 1913 erfolgte die Schutzaktion zur Erhaltung
des Landschaftsbildes im Hönnetal. 1919 verpflichtete sich das Deutsche
Reich mit dem Artikel 150 der Weimarer Reichsverfassung zur „Erhaltung
und Pflege der Natur“. 1935 trat das Reichsnaturschutzgesetz (
)
eingerichtet. Der Naturschutzpark Lüneburger Heide entand 1910 in
privater Initiative (Verein Naturschutzpark e.V.; die staatliche Ausweisung
als Naturschutzgebiet erfolgte erst 1921). 1912 wurde der Pflanzenschonbezirk
Berchtesgadener Alpen fertiggestellt - als Vorläufer des heutigen
Nationalpark Berchtesgaden. 1913 erfolgte die Schutzaktion zur Erhaltung
des Landschaftsbildes im Hönnetal. 1919 verpflichtete sich das Deutsche
Reich mit dem Artikel 150 der Weimarer Reichsverfassung zur „Erhaltung
und Pflege der Natur“. 1935 trat das Reichsnaturschutzgesetz ( )
- die Grundlage für alle späteren Naturschutzgesetze in Deutschland
- in Kraft.
)
- die Grundlage für alle späteren Naturschutzgesetze in Deutschland
- in Kraft.
Der WWF wurde 1961 gegründet. Europäisches
Naturschutzjahr war das Jahr 1970. 1972 erregte der „Club
of Rome“ (






 )
mit Dennis Meadows und seinem Buch (Titel: Die Grenzen des Wachstums) ein
weiteres großes öffentliches Interesse am Naturschutz. Wir stellen
mit dem Naturschützer, Ökologen und Biologen Josef H. Reichholf fest,
daß grenzenloses Wachstum, perfektes Recycling, perfekte Nachhaltigkeit
unmöglich sind! Denn „gäbe es tatsächlich vollständige
Kreislaufwirtschaften (ein perfektes Recycling), würde dies den Grundgesetzen
der Natur widersprechen, genauer: dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik (
)
mit Dennis Meadows und seinem Buch (Titel: Die Grenzen des Wachstums) ein
weiteres großes öffentliches Interesse am Naturschutz. Wir stellen
mit dem Naturschützer, Ökologen und Biologen Josef H. Reichholf fest,
daß grenzenloses Wachstum, perfektes Recycling, perfekte Nachhaltigkeit
unmöglich sind! Denn „gäbe es tatsächlich vollständige
Kreislaufwirtschaften (ein perfektes Recycling), würde dies den Grundgesetzen
der Natur widersprechen, genauer: dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik ( ).
Die perfekte Nachhaltigkeit wäre ein »Perpetuum mobile«. Sie
ist eine Unmöglichkeit. Somit kann Nachhaltigkeit ohne steuernde und ergänzende
Eingriffe durch den Menschen nur bedeuten, vorhandene Ressourcen so schonend zu
nutzen, daß sie möglichtst lange vorhalten. Das bedeutet Verzicht in
der Gegenwart zugunsten späterer Nutzungen. Verzichten kann man dort am ehesten,
wo viel vorhanden ist. Herrscht Mangel, schränkt dieser die Nutzungsmöglichkeiten
entsprechend ein. Kapital für die Zukunft läßt sich unter solchen
Bedingungen schwerlich zurückhalten und aufbauen. Wo hingegen Überschüsse
vorhanden oder (leicht) zu erwirtschaften sind, könnte zwar gespart werden,
aber so ein zurückhaltend-schondender Umgang mit den Ressourcen erzeugt unausweichlich
das Problem der Konkurrenz. Wer in der Gegenwart mehr Umsatz macht, gewinnt Vorteile.
Und das um so mehr, je stärker sich der Konkurrent zurückhält.
Konventionen und Beschränkungen sollen in der menschlichen Gesellschaft die
Wirtschaft »sozial« - und damit im Zaum - halten. Das gelingt bekanntlich
selbst innerhalb eines Staates zumeist nur unbefriedigend. Zwischen den Staaten
und insbesondere zwischen verschiedenen Wirtschaftssystemen funktioniert die Zurückhaltung
zugunsten der Zukunft noch weniger. Wer nur ein wenig abweicht, gewinnt gleich
viel, solange sich die anderen beschränken. Der Verbrauch an Ressourcen wird
dadurch kaum gebremst. Das hat die jüngste Vergangenheit seit den weltweit
verbreiteten Warnungen von der Endlichkeit der Ressourcen durch den »Club
of Rome« und die »Grenzen des Wachstums« von Dennis Meadows
klar gezeigt. Sicher hätten Meadows und der »Club of Rome« recht
bekommen mit ihren Hochrechnungen, wenn seit den 1970er Jahren nicht neue Funde
von Ressourcen und veränderte Technologien die Grenze(n) hinausgeschoben
hätten. Daß es um die Jahrtausendwende nicht zum prognostizierten globalen
Crash gekommen ist, verdanken wir auf keinen Fall einsichtigem Handeln nach dem
Prinzip der Nachhaltigkeit, sondern neuen Funden von Vorräten und verbesserten
Technologien.“ (Josef H. Reichholf, Stabile Ungleichgewichte, 2008,
S. 117-118
).
Die perfekte Nachhaltigkeit wäre ein »Perpetuum mobile«. Sie
ist eine Unmöglichkeit. Somit kann Nachhaltigkeit ohne steuernde und ergänzende
Eingriffe durch den Menschen nur bedeuten, vorhandene Ressourcen so schonend zu
nutzen, daß sie möglichtst lange vorhalten. Das bedeutet Verzicht in
der Gegenwart zugunsten späterer Nutzungen. Verzichten kann man dort am ehesten,
wo viel vorhanden ist. Herrscht Mangel, schränkt dieser die Nutzungsmöglichkeiten
entsprechend ein. Kapital für die Zukunft läßt sich unter solchen
Bedingungen schwerlich zurückhalten und aufbauen. Wo hingegen Überschüsse
vorhanden oder (leicht) zu erwirtschaften sind, könnte zwar gespart werden,
aber so ein zurückhaltend-schondender Umgang mit den Ressourcen erzeugt unausweichlich
das Problem der Konkurrenz. Wer in der Gegenwart mehr Umsatz macht, gewinnt Vorteile.
Und das um so mehr, je stärker sich der Konkurrent zurückhält.
Konventionen und Beschränkungen sollen in der menschlichen Gesellschaft die
Wirtschaft »sozial« - und damit im Zaum - halten. Das gelingt bekanntlich
selbst innerhalb eines Staates zumeist nur unbefriedigend. Zwischen den Staaten
und insbesondere zwischen verschiedenen Wirtschaftssystemen funktioniert die Zurückhaltung
zugunsten der Zukunft noch weniger. Wer nur ein wenig abweicht, gewinnt gleich
viel, solange sich die anderen beschränken. Der Verbrauch an Ressourcen wird
dadurch kaum gebremst. Das hat die jüngste Vergangenheit seit den weltweit
verbreiteten Warnungen von der Endlichkeit der Ressourcen durch den »Club
of Rome« und die »Grenzen des Wachstums« von Dennis Meadows
klar gezeigt. Sicher hätten Meadows und der »Club of Rome« recht
bekommen mit ihren Hochrechnungen, wenn seit den 1970er Jahren nicht neue Funde
von Ressourcen und veränderte Technologien die Grenze(n) hinausgeschoben
hätten. Daß es um die Jahrtausendwende nicht zum prognostizierten globalen
Crash gekommen ist, verdanken wir auf keinen Fall einsichtigem Handeln nach dem
Prinzip der Nachhaltigkeit, sondern neuen Funden von Vorräten und verbesserten
Technologien.“ (Josef H. Reichholf, Stabile Ungleichgewichte, 2008,
S. 117-118 ).
).
Naturschutz sei kaum noch möglich, so
Harald Lesch 2009, weil wir uns und mit uns auch andere Lebewesen in fremde
Gebiete bringen und dabei z.B. mit unseren Containerschiffen ungefähr
1 Milliarde mal schneller bewegen als die Kontinentaldrift (eine wenige
Zentimeter pro Jahr [wie auch z.B. unsere Fingernägel] ),
die ja in etwa identisch ist mit der natürlichen Ausbreitung. „Was
wir anrichten, ist eine Beschleunigung der Zuwanderung: Von ursprünglich
- also natürlicherweise - 10 Arten pro Millionen Jahre sind es jetzt
10 Arten pro Jahr. Die Evolution wird von uns einfach überrollt.
Wie eine Tsunamiwelle rasen die Invasoren in ihre neue Umwelt. Ja, und
dann heißt es: Die Natur soll geschützt werden. Nur: Welche
Natur sollen und wollen wir eigentlich schützen?“ (Harald
Lesch, in der Fernsehsendung Abenteuer Forschung, Januar 2009).
So etwas Komplexes wie die Natur läßt sich offenbar nicht „untertan
machen“, wie es in der Bibel heißt, auch nicht kontrollieren,
wie Unverbesserliche meinen. „Das Reich der biologischen Möglichkeiten
ist derartig groß, daß wir nie wirklich sicher sein können,
was wir eigentlich anrichten.“ (Ebd.). Aber wir können jetzt
nicht resignieren, denn wenn wir keinen Naturschutz mehr betreiben würden,
würden sehr viele Lebewesen, darunter auch wir Menschen, von einer
möglichen riesigen Katastrophe noch eher betroffen sein. Außerdem
spricht Lesch, seit er nicht mehr in einer BR-Nachtsendung, sondern in
einer ZDF-Abendsendung sprechen darf, über die Natur so, als sei
er vom Physiker zum Lobbyisten umoperiert worden.
),
die ja in etwa identisch ist mit der natürlichen Ausbreitung. „Was
wir anrichten, ist eine Beschleunigung der Zuwanderung: Von ursprünglich
- also natürlicherweise - 10 Arten pro Millionen Jahre sind es jetzt
10 Arten pro Jahr. Die Evolution wird von uns einfach überrollt.
Wie eine Tsunamiwelle rasen die Invasoren in ihre neue Umwelt. Ja, und
dann heißt es: Die Natur soll geschützt werden. Nur: Welche
Natur sollen und wollen wir eigentlich schützen?“ (Harald
Lesch, in der Fernsehsendung Abenteuer Forschung, Januar 2009).
So etwas Komplexes wie die Natur läßt sich offenbar nicht „untertan
machen“, wie es in der Bibel heißt, auch nicht kontrollieren,
wie Unverbesserliche meinen. „Das Reich der biologischen Möglichkeiten
ist derartig groß, daß wir nie wirklich sicher sein können,
was wir eigentlich anrichten.“ (Ebd.). Aber wir können jetzt
nicht resignieren, denn wenn wir keinen Naturschutz mehr betreiben würden,
würden sehr viele Lebewesen, darunter auch wir Menschen, von einer
möglichen riesigen Katastrophe noch eher betroffen sein. Außerdem
spricht Lesch, seit er nicht mehr in einer BR-Nachtsendung, sondern in
einer ZDF-Abendsendung sprechen darf, über die Natur so, als sei
er vom Physiker zum Lobbyisten umoperiert worden.
Der Naturschutz kann trotz seiner gerade in
der jüngeren Vergangenheit gemachten Fehler immer noch auf seine
Erfolge verweisen. „Nur fällt es dem staatlichen, noch mehr
aber dem in Verbänden organisierten Naturschutz sehr schwer, die
vielen und höchst beachtlichen Erfolge zu verkünden, obgleich
es sie gibt und obwohl der private Naturschutz wirklich stolz auf das
unter solch widrigen Rahmenbedingungen Erreichte sein kann. Viele Arten
haben kräftig zugenommen, vor allem größere Säugetiere
und Vögel, die früher verfolgt worden waren und nun seit Jahrzehnten
geschützt sind. In Mitteleuropa leben gegenwärtig mehr Großvögel
und größere Säugetiere als seit vielen Jahrhunderten.“
(Josef H. Reichholf, Eine kurze Naturgeschichte des letzten Jahrtausends,
2007, S. 237 ).
Vielleicht ist Herrn Reichholf einfach nur noch nicht aufgefallen, daß
die Anzahl der Insekten rapide zurückgegangen ist, so auch die der
Vögel, Fledermäuse, Mäuse und vieler anderer Tiere, daß
die Böden fast nichts mehr hergeben für die ihn benötigenden
Tiere und die anderen Tiere durch die Windindustrie getötet werden.
).
Vielleicht ist Herrn Reichholf einfach nur noch nicht aufgefallen, daß
die Anzahl der Insekten rapide zurückgegangen ist, so auch die der
Vögel, Fledermäuse, Mäuse und vieler anderer Tiere, daß
die Böden fast nichts mehr hergeben für die ihn benötigenden
Tiere und die anderen Tiere durch die Windindustrie getötet werden.
„Der Bevölkerung wird ein ziemlich verzerrtes Bild vom tatsächlichen
Zustand unserer Natur vermittelt. In weiten Bereichen Mitteleuropas gibt
es inzwischen, abgesehen von wenigen, mit gewisser Berechtigung als gefährlich
eingestuften Großraubtieren (Braunbär, Wolf), wieder das nahezu
gesamte Spektrum an Säugetieren wie vor 200 oder 250 Jahren. Die
meisten kommen sogar erheblich häufiger vor als in früheren
Jahrhunderten. Neue Arten kamen hinzu, so daß auch bei den Säugern,
wie bei den Vögeln, die Gesamtbilanz nach 100 Jahren positiv aussieht.
Mit den paar noch fehlenden »Großen« würden wir
durchaus auch leben können ....“ (Josef H. Reichholf, Eine
kurze Naturgeschichte des letzten Jahrtausends, 2007, S. 243 ).
In den 1970er Jahren war es noch so, daß man die Wasseranlage für
die Scheibenwischer bei gutem Wetter während der entsprechenden Jahreszeit
nur wegen der vielen Insekten anstellen mußte. Wie ist es heute?
Es sind gar keine Insekten mehr an der Windschutzscheibe, und zwar unabhängig
davon, welches Wetter und welche Jahreszeit gerade ist. Dank Massenmord!
Keine Insekten mehr an der Windschutzscheibe!
).
In den 1970er Jahren war es noch so, daß man die Wasseranlage für
die Scheibenwischer bei gutem Wetter während der entsprechenden Jahreszeit
nur wegen der vielen Insekten anstellen mußte. Wie ist es heute?
Es sind gar keine Insekten mehr an der Windschutzscheibe, und zwar unabhängig
davon, welches Wetter und welche Jahreszeit gerade ist. Dank Massenmord!
Keine Insekten mehr an der Windschutzscheibe!
„Zusammengefaßt
bedeutet dies, daß für die größere Tierwelt, insbesondere
für Säugetiere und Vögel, unsere Zeit nicht die schlechteste
ist. Viele Arten treten viel häufiger auf als früher. Manche,
die am Rand der Ausrottung waren, kommen ... bei uns in Deutschland längst
wieder in gut gesicherten Beständen vor. Anzuführen sind hierzu
neben den fast überall so erfolgreich wiedereingebürgerten Bibern
und den »an den Grenzen im Osten stehenden« Elchen, die wohl
bald, wie schon nach Österreich, auch nach Deutschland kommen werden,
insbesondere Großvögel wie Kranich (Grus grus), Schwarzstorch
(Ciconia nigra), Seeadler (Haliaaetus albicilla) und Fischadler
(Pandion haliaetus). Die beiden letzteren kommen nach weltweiten
Maßstäben in Ostdeutschland inzwischen in den größten
örtlichen Beständen überhaupt vor. Ihre Brutvorkommen weiten
sich aus. Bei See- und Fischadler ist zu erwarten, daß sie in naher
Zukunft in Deutschland schon mit jeweils 500 Brutpaaren vertreten sein
werden. Der Niedergang des Weißstorchs (Ciconia ciconia)
konnte in den letzten beiden Jahrzehnten erfolgreich gestoppt und offenbar
in eine Wiedererholung des Bestandes umorientiert werden. Steinadler (Aquila
chrysaetos) besiedeln den deutschen Alpenrand Revier an Revier, und
auch die größte Eule, der Uhu (Bubo bubo )
gehört zu den Gewinnern im Artenschutz. Mancher Fluß hat wieder
Lachse (Salmo salar) oder Huchen (Hucho hucho) und an der
deutschen Nordseeküste entwickelte sich nach Einstellung der Jagd
der Bestand des Seehundes (Phoca vitulina) im Wattenmeer steil
aufwärts. Ausflügler können die zunehmend vertrauter werdenden
Robben nun wieder an zahlreichen Stellen bewundern. Der Naturschutz hat
sich gelohnt. Er war erfolgreich, und die Anstrengungen, das Erreichte
zu erhalten, müssen fortgesetzt werden. Die Nutzungsinteressen anderer
bedrängen die meisten der häufiger gewordenen Arten schon wieder.
Die tatsächlich starken Rückgänge bei vielen kleinen Arten,
die ... von sonnigen, trockenen und »mageren« Lebensräumen
abhängen oder denen die Moore und Sümpfe trockengelegt und in
fettes Agrarland umgewandelt wurden, bilden die Verlustseite in der Entwicklung
im Artenspektrum der Tiere und Pflanzen in Mitteleuropa. Die Bestandserholungen
und Zugewinne gerade bei den größeren und auffälligeren
Arten schlagen als Gewinne zu Buche. Die Natur Mitteleuropas ist im 20.
Jahrhundert, vor allem in dessen zweiter Hälfte, sicherlich sehr
stark verändert worden. Aber unsere Tier- und Pflanzenwelt stellt
keinen hoffnungslosen Fall dar. Wir kennen die Gründe der Gefährdung
und könnten diese daher, anders als das Wetter und das Klima (
)
gehört zu den Gewinnern im Artenschutz. Mancher Fluß hat wieder
Lachse (Salmo salar) oder Huchen (Hucho hucho) und an der
deutschen Nordseeküste entwickelte sich nach Einstellung der Jagd
der Bestand des Seehundes (Phoca vitulina) im Wattenmeer steil
aufwärts. Ausflügler können die zunehmend vertrauter werdenden
Robben nun wieder an zahlreichen Stellen bewundern. Der Naturschutz hat
sich gelohnt. Er war erfolgreich, und die Anstrengungen, das Erreichte
zu erhalten, müssen fortgesetzt werden. Die Nutzungsinteressen anderer
bedrängen die meisten der häufiger gewordenen Arten schon wieder.
Die tatsächlich starken Rückgänge bei vielen kleinen Arten,
die ... von sonnigen, trockenen und »mageren« Lebensräumen
abhängen oder denen die Moore und Sümpfe trockengelegt und in
fettes Agrarland umgewandelt wurden, bilden die Verlustseite in der Entwicklung
im Artenspektrum der Tiere und Pflanzen in Mitteleuropa. Die Bestandserholungen
und Zugewinne gerade bei den größeren und auffälligeren
Arten schlagen als Gewinne zu Buche. Die Natur Mitteleuropas ist im 20.
Jahrhundert, vor allem in dessen zweiter Hälfte, sicherlich sehr
stark verändert worden. Aber unsere Tier- und Pflanzenwelt stellt
keinen hoffnungslosen Fall dar. Wir kennen die Gründe der Gefährdung
und könnten diese daher, anders als das Wetter und das Klima (


 ),
an geeigneten Orten und im nötigen Umfang durchaus gezielt ändern.“
(Josef H. Reichholf, Eine kurze Naturgeschichte des letzten Jahrtausends,
2007, S. 243-244
),
an geeigneten Orten und im nötigen Umfang durchaus gezielt ändern.“
(Josef H. Reichholf, Eine kurze Naturgeschichte des letzten Jahrtausends,
2007, S. 243-244 ).
Nicht die Vergangenheit, sondern die Gegenwart ist hauptschuldig! Und
durch Massenimmigration werden unzählige heimische Arten zum Aussterben
gebracht. Seit es die politische Partei mit dem verlogenen Namen „Die
Grünen“ gibt, ist die Zerstörung der Natur ins Unermeßliche
gestiegen. Kein Wunder, denn wenn es keine Umweltzerstöung mehr gäbe,
wäre diese miese Partei am Ende, folglich sorgt sie für mehr
und immer mehr Umweltzerstörung. „Die Grünen“ sind
die Anti-Grünen.
).
Nicht die Vergangenheit, sondern die Gegenwart ist hauptschuldig! Und
durch Massenimmigration werden unzählige heimische Arten zum Aussterben
gebracht. Seit es die politische Partei mit dem verlogenen Namen „Die
Grünen“ gibt, ist die Zerstörung der Natur ins Unermeßliche
gestiegen. Kein Wunder, denn wenn es keine Umweltzerstöung mehr gäbe,
wäre diese miese Partei am Ende, folglich sorgt sie für mehr
und immer mehr Umweltzerstörung. „Die Grünen“ sind
die Anti-Grünen.
„Die tropischen Regenwälder waren nach dem nordischen Nadelwald,
der Taiga, die sich über den borealen Bereich von Eurasien und Nordamerika
erstreckt, bis in die jüngste Vergangenheit die größten
Wälder der Erde. Noch um die
Mitte des 20. Jahrhunderts bedeckten die tropischen Regenwälder,
fast unangetastet, eine Fläche von rund 12 Millionen Quadratkilometern
( ).
Zur Jahrtausendwende, also nur 50 Jahre später, war davon bereits
etwa die Hälfte vernichtet. Satellitenaufnahmen, die seit den 1990er
Jahren mit guter Auflösungsqualität vorliegen, belegen, daß
seit 1994 allein im Regenwald Amazoniens pro Jahr zwischen 1,5 und 3 Millionen
Hektar abgeholzt und abgebrannt worden sind. Eine derart hohe Entwaldungsrate
hatte es nur während der Vernichtung der Wälder in den heutigen
USA etwa zwischen 1750 und 1900 gegeben. Dieser Waldvernichtung fiel der
Laubwald der gemäßigten Klimazone Nordamerika bis auf wenige
Prozent Restvorkommen zum Opfer. Die jährliche Rodungsrate bewegte
sich damals im Durchschnitt zwischen 0,7 und 1 Prozent pro Jahr; in Brasilien
liegt sie für die letzten 50 Jahre bei 2,2 Prozent pro Jahr. Europa
hatte seine bewaldeten Landschaften im Verlauf von 1500 Jahren mit einer
Geschwindigkeit von 0,1 bis höchstens 0,3 Prozent pro Jahr verändert.
Die größten historischen Rodungen fanden ... im frühen
Mittelalter statt. Der gegenwärtige Waldbestand macht in Mitteleuropa
rund ein Drittel der Landesfläche aus. Dieser Wert liegt höher
als in Brasilien, das mit dem größten Anteil an den amazonischen
Regenwäldern auch der Hauptakteur in der Tropenwaldvernichtung ist.
Von 1990 bis 1995 rodete Brasilien allein 128000 Quadratkilometer ....“
(Josef H. Reichholf, Eine kurze Naturgeschichte des letzten Jahrtausends,
2007, S. 245-246).
).
Zur Jahrtausendwende, also nur 50 Jahre später, war davon bereits
etwa die Hälfte vernichtet. Satellitenaufnahmen, die seit den 1990er
Jahren mit guter Auflösungsqualität vorliegen, belegen, daß
seit 1994 allein im Regenwald Amazoniens pro Jahr zwischen 1,5 und 3 Millionen
Hektar abgeholzt und abgebrannt worden sind. Eine derart hohe Entwaldungsrate
hatte es nur während der Vernichtung der Wälder in den heutigen
USA etwa zwischen 1750 und 1900 gegeben. Dieser Waldvernichtung fiel der
Laubwald der gemäßigten Klimazone Nordamerika bis auf wenige
Prozent Restvorkommen zum Opfer. Die jährliche Rodungsrate bewegte
sich damals im Durchschnitt zwischen 0,7 und 1 Prozent pro Jahr; in Brasilien
liegt sie für die letzten 50 Jahre bei 2,2 Prozent pro Jahr. Europa
hatte seine bewaldeten Landschaften im Verlauf von 1500 Jahren mit einer
Geschwindigkeit von 0,1 bis höchstens 0,3 Prozent pro Jahr verändert.
Die größten historischen Rodungen fanden ... im frühen
Mittelalter statt. Der gegenwärtige Waldbestand macht in Mitteleuropa
rund ein Drittel der Landesfläche aus. Dieser Wert liegt höher
als in Brasilien, das mit dem größten Anteil an den amazonischen
Regenwäldern auch der Hauptakteur in der Tropenwaldvernichtung ist.
Von 1990 bis 1995 rodete Brasilien allein 128000 Quadratkilometer ....“
(Josef H. Reichholf, Eine kurze Naturgeschichte des letzten Jahrtausends,
2007, S. 245-246).
„Amazonien
enthält (enthielt) mit etwa 55 Prozent mehr als die Hälfte aller Regenwälder
der Tropen. Der Fläche nach folgt Afrika mit dem Kongobecken. Teile der südostasiatischen
Inselwelt bedeckt gleichfalls (noch) Regenwald. Die bedeutendsten Flächen
finden sich auf Neuguinea und Borneo. Die südasiatischen Regenwaldreste sind
hingegen so klein, daß sie in der globalen Bilanz in den Schwankungsbereichen
der regionalen Angaben für die großen Regenwaldgebiete verschwinden.
Von den 12 Ländern mit den größten Verlusten an Tropenwäldern
seit den 1990er Jahren liegt mit Brasilien, Bolivien, Venezuela, Mexiko und Paraguay
die Mehrzahl im tropischen Amerika. In Afrika trugen nur der Kongo und der (südliche)
Sudan stark zur Tropenwaldvernichtung bei; in Südostasien Indonesien, Malaysia
und Thailand. Doch während in diesen Ländern der asiatischen Regenwaldzone
durchschnittlich fast 100 Menschen pro Quadratkilometer leben, sind es in den
amazonischen Regenwaldländern, wo die größte Waldvernichtung stattfindet,
nur 16 und in Afrika 21 Menschen pro Quadratkilometer. Zum Vergleich: In Deutschland
leben lm Durchschmtt 233 Menschen je Quadratkilometer, im südasiatischen
Bangladesch 825 und in Indien derzeit etwa 300. Damit entfielen pro Brasilianer
0,75 Hektar vernichteter Regenwald von 1990 bis 1995, aber nur 0,25 Hektar pro
Einwohner in Indonesien und 0,08 im Kongo im selben Zeitraum. Der Kongo hatte
aber einen Bevölkerungszuwachs von 3,2 Prozent pro Jahr, Indonesien von 1,7
Prozent und Brasilien von 1,4 Prozent. Somit stehen Bevölkerungszuwachs und
Bevölkerungsdichte in keinem (positiven) Zusammenhang zur Rate der Waldvernichtung.
.... Aus diesen Daten geht somit klar hervor, daß kein Zusammenhang besteht
zwischen der Bevölkerungszunahme und dem Ausmaß der Waldvernichtung.
Das Land mit der mit weitem Abstand größten Vernichtungsrate, Brasilien,
hat mit nur 20 Menschen pro Quadratkilometer zudem bloß ein Fünftel
der Besiedlungsdichte der Nummer 2, lndonesien, mit über 100 Menschen pro
Quadratkilometer. Mit der üblichen Ansicht, die Tropenwälder würden
dem Bevölkerungswachstum der Menschheit zum Opfer fallen, weil sich diese
seit 1950 von 2,5 Milliarden auf nunmehr schon 6,4 Milliarden vergrößert
hat ( ),
stimmen diese Befunde also nicht überein.“ (Josef H. Reichholf, Eine
kurze Naturgeschichte des letzten Jahrtausends, 2007, S. 246-247).
),
stimmen diese Befunde also nicht überein.“ (Josef H. Reichholf, Eine
kurze Naturgeschichte des letzten Jahrtausends, 2007, S. 246-247).
„Welche Gründe gibt es dann? Bevor diese Frage behandelt wird, sollte jedoch geklärt werden, warum man sich überhaupt so sehr über die Tropenwaldvernichtung sorgt, wo doch, wie oben ausgeführt, die USA in den beiden vorletzten Jahrhunderten in noch viel größerem Umfang ihre Wälder (abgesehen von Alaska) vernichtete und in Europa sowie anderen Regionen der Erde die Entwaldung längst Geschichte ist. Eine häufig vorgebrachte Begründung, die tropischen Regenwälder seien die Lungen der Erde, die dafür sorgen, daß wir genügend Sauerstoff haben, stimmt so nicht. Tatsächlich erzeugt ein ausgewachsener Tropenwald wie jeder andere Wald auch, der keinen Zuwachs mehr hat, kein bißchen Sauerstoff. Denn dieselbe Menge, die tatsächlich bei der Photosynthese von den Blättern oder Nadeln abgegeben wird, verbraucht der ausgewachsene Wald wieder für Atmung und Zersetzung der erzeugten Stoffe im Boden. Nur wachsende Wälder können in der Nettobilanz Sauerstoff freisetzen und im Gegenzug Kohlenstoff aus der Atmosphäre (in Form von CO2) aufnehmen und binden. Ansonsten gibt der Wald auch wieder das CO2 ab, das er aufgenommen hat. Insofern stimmt der Vergleich mit der Lunge nur halb. Diese atmet letztlich dieselbe Menge Kohlendioxid aus, wie sie Sauerstoff aufnimmt. In anderer Hinsicht spielt der Vergleich aber durchaus eine Rolle. Da in nur 50 Jahren etwa die Hälfte der Tropenwälder vernichtet worden ist und davon der weitaus größte Teil ihrer pflanzlichen Masse (Biomasse) verbrannt wurde und in Rauch aufgegangen ist, ohne daß entsprechende Mengen durch nachwachsende Vegetation wieder der Luft entnommen worden wären, trug ihre Vernichtung sehr stark zur Zunahme von CO2 und Ruß in der Atmosphäre bei. Wie schon ausgeführt, übertrifft die Verbrennung von Tropenwäldern und Savannen jedes Jahr den gesamten Umsatz von Energie in Deutschland ganz erheblich. Die Vernichtung der Tropenwälder trägt gleich in dreifacher Weise zur Belastung der Erdatmosphäre bei, nämlich durch die direkte Aufheizung mit der von den Bränden freigesetzten Wärme, durch die CO2-Abgabe und durch die Erzeugung von riesigen Mengen Methan (CH4) durch die Rinder und Termiten, die auf den solcherart geschaffenen oder »verbesserten« Weideflächen leben. Rinder und Termiten liefern mehr als die Hälfte des Methans, das als Treibhausgas in die Atmosphäre gelangt und dort über 20-mal stärker als das Kohlendioxid wirkt. Im Gegensatz zu diesem, das bekanntlich Hauptnährstoff für die Pflanzen ist, wird Methan nur von wenigen spezialisierten Bakterien verwertet, die für den Menschen keine Rolle spielen.“ (Josef H. Reichholf, Eine kurze Naturgeschichte des letzten Jahrtausends, 2007, S. 247-249).
„Hinzuzufügen ist weiterhin, daß sich großflächige
Rodungen in den Tropen selbstverständlich auch weit stärker aufheizen
als die Wälder, die es vorher an ihrer Stelle gegeben hatte. Man kennt dies
aus eigener Erfahrung von der Kühlwirkung des Waldes an heißen Tagen.
Die Verdunstung von Wasser, die Transpiration, durch die Bäume bewirkt eine
starke Kühlung. In den Tropen kann sie mehr als l0°C ausmachen. Gleichzeitig
erzeugt dieses transpirierte Wasser immer wieder Wolken und Niederschläge,
so daß sich große tropische Regenwälder zu einem Gutteil selbst
mit Wasser versorgen. In Oberamazonien stammen bis über 80 Prozent des Niederschlagwassers
aus diesem sogenannten kleinen Kreislauf. Er setzt das vom Atlantik mit den Passatwinden
antransportierte Wasser mehrfach um, bis es wieder über den Amazonas zum
Ozean zuruckfließt. Werden zu große Waldflächen vernichtet und
in Weideland oder Sojafelder umgewandelt, nehmen infolgedessen die Niederschläge
ab, während sich gleichzeitig die Atmosphäre weit stärker als über
Wald aufheizt. Es scheint zwar noch nicht ganz geklärt zu sein, ob die Vermutung
zutrifft, daß die Häufigkeit der Tropenstürme und Hurrikane in
der Karibik mit der zunehmenden Aufheizung der inneren Tropen mit den großflächigen
Waldrodungen zusammenhängt. Zahlreiche gute Indizien sprechen jedoch dafür.
So wie wir umgekehrt inzwischen auch wissen, daß die Tropenwälder Amazoniens
deshalb existieren und ihre unvermeidbaren Verluste an mineralischen Nährstoffen
ausgleichen können, weil die Passatwinde Nährstoffe aus der Sahara herüberwehen.
Die amazonischen Wälder wachsen nämlich fast überall auf äußerst
unfruchtbaren Böden, die außer Sand und Kaolinit kaum weitere Mineralien
enthalten. Globale Zusammenhänge gibt es also sehr wohl in den Tropen - wie
auch in außertropischen Regionen. Wo die natürlichen Transportwege
nicht ablaufen können, hat der Mensch inzwischen neue geschaffen. Gegenwärtig
fließt ein gewaltiger Strom von Nährstoffen aus den südamerikanischen
Tropen nach Europa und ernährt das Vieh in den Ställen ( ).
Europäische, vor allem auch deutsche und französische Rinder »fressen
Tropenwälder auf«, weil für unser Stallvieh dort die Futtermittel
angebaut werden, die hier nicht zur Verfügung stehen. Denn unsere Viehbestände
sind viel zu hoch für eine Selbstversorgung auf mitteleuropäischem Weideland
oder mit heimischem Futtergetreide. Die Mast von Geflügel kommt mit weit
über 100 Millionen Hähnchen allein in Deutschland hinzu. Der Nutzviehbestand
übertrifft hierzulande das Lebendgewicht aller Menschen um das Drei- bis
Fünffache.“ (Josef H. Reichholf, Eine kurze Naturgeschichte des letzten
Jahrtausends, 2007, S. 249-250).
).
Europäische, vor allem auch deutsche und französische Rinder »fressen
Tropenwälder auf«, weil für unser Stallvieh dort die Futtermittel
angebaut werden, die hier nicht zur Verfügung stehen. Denn unsere Viehbestände
sind viel zu hoch für eine Selbstversorgung auf mitteleuropäischem Weideland
oder mit heimischem Futtergetreide. Die Mast von Geflügel kommt mit weit
über 100 Millionen Hähnchen allein in Deutschland hinzu. Der Nutzviehbestand
übertrifft hierzulande das Lebendgewicht aller Menschen um das Drei- bis
Fünffache.“ (Josef H. Reichholf, Eine kurze Naturgeschichte des letzten
Jahrtausends, 2007, S. 249-250).
„Unsere Massentierhaltung könnte ohne die Importe von Futtermitteln, die auf ehemaligen Tropenwaldflächen erzeugt werden, nicht existieren. Deshalb trifft uns der zweite Vorwurf, der mit der Tropnewaldvernichtung verbunden wird: Vernichtung der Biodervisität. Schon die ersten Naturforscher, die sich intensiver mit den Tieren und Pflanzen der Tropenwälder befaßten (allen voran: Alexander von Humboldt; HB), waren von deren Artenfülle beeindruckt. Sie schien unerschöpflich, weil überall, wo sie genauer suchten, neue Arten zu entdecken waren. Daran hat sich bis heute kaum etwas geändert. Denn auch heute kann nicht einmal eine ungefähre Abschätzung vom Artenreichtum der Tropen vorgenommen werden. Verschiedene Hochrechnungen ergaben Werte zwischen 5 und mehr als 30 Millionen unterschiedlicher Arten. Bekannt und wissenschaftlich beschrieben sind aber bislang nur 1,8 Millionen Arten. Wenn auch in gemäßigten Breiten, die auf jeden Fall viel artenärmer als die Tropen sind, Jahr für Jahr neue Arten erkannt werden, so weiß man doch hier ganz gut Bescheid. In den Tropen gibt es jedoch zehn- bis hundertmal mehr als in unseren Breiten. In mitteleuropäischen Wäldern wachsen pro Quadratkilometer zwischen 5 und 20 verschiedene Arten von Holzgewächsen (Bäume und Sträucher), sofern es sich um Mischwälder handelt und nicht um gepflanzte Einheitsforste. In tropischen Regenwäldern können auf dem Hundertstel eines Quadratkilometers, einem Hektar, aber mehrere hundert verschiedene Arten von Holzgewächsen vorkommen. In Amazonien und in Südostasien wurden über 500 Arten von Bäumen und Lianen auf einem Hektar ermittelt. Vogelarten gibt es doppelt bis viermal so viele pro Quadratkilometer wie in unseren Wäldern, Schmetterlingsarten aber hundertmal mehr. Doch diese Vielfalt verbindet sich ... mit Seltenheit. Die meisten Arten der Tropen sind nach europäischen oder nordamerikanischen Standards selten bis sehr selten. Schon die frühen Naturforscher stellten zu ihrer Verwunderung in unberührten Regenwäldern fest, daß es viel leichter ist, zehn verschiedene Arten von Schmetterlingen zu sammeln als zehn Exemplare einer einzigen solchen Art. In dieser Seltenheit liegt die Verletztlichkeit des tropischen Artenreichtums. Die seltenen Arten sterben viel schneller aus als die häufigen, und sie sind, was noch bedeutsamer ist, oft sehr kleinflächig verbreitet. Vielfach bilden die Arten so etwas wie ein höchst kompliziertes Mosaik, in dem jedes Steinchen eine Art mit winzigem Verbreitungsgebiet repräsentiert. Wird so ein Steinchen entfernt, kommt diese Art unter Umständen nirgendwo mehr vor. Die Forscher, die sich mit der tropischen Biodiversität intensiv befassen, rechnen deshalb mit immensen Artenverlusten, weil auf den gerodeten Flächen viele Arten vorgekommen sein dürften, die nun nicht mehr existieren. Man hat mit den örtlichen Waldflächen auch ihren Lebensraum vernichtet. Hieraus kann man die schon angedeuteten Hochrechnungen anstellen. Sie ergeben für die derzeitige Vernichtungsrate tropischer Wälder Größenordnungen von einer aussterbenden Art pro Stunde bis zu 500 Arten täglich. Wie viele es wirklich sind, weiß niemand, weil die ausgerotteten Arten nicht bekannt sind. Ihre Anzahl hängt entscheidend davon ab, welche Größenordnung für den globalen Artenreichtum insgesamt zugrunde gelegt werden muß. Die Angaben aus dem internationalen Naturschutz sind somit keine wilden, grundlosen Schätzungen oder gar haltlose Vermutungen, sondern Rechenergebnisse auf einer nicht hinreichend bekannten Basis. Sicher können wir nur sein, daß es ein großes Artensterben in unserer Zeit gibt. Wie groß es ist, könnten wir rasch erfahren, wenn ein paar Prozent der Geldmengen, die in den Weltraum geschossen werden, der Erfassung der Lebensvielfalt der Erde zur Verfügung gestellt würden.“ (Josef H. Reichholf, Eine kurze Naturgeschichte des letzten Jahrtausends, 2007, S. 251-253).
„Bei diesem errechneten Artensterben in den Tropen handelt es sich daher um etwas grundsätzlich anderes als bei den »Rote Liste«-Arten in Deutschland und anderen Gebieten Europas. Die allermeisten Pflanzen- und Tierarten kommen weit verbreitet in Europa und Asien vor. Der Artenschutz beklagt ihr örtliches oder regionales Verschwinden, nicht ihr generelles Aussterben, wie es den großen Walen drohte oder dem Großen Panda, allen noch lebenden Arten der Nashörner und den fast 2000 verschiedenen Vogelarten, die vor allem in Amazonien und Südostasien direkt vom Aussterben bedroht sind.“ (Josef H. Reichholf, Eine kurze Naturgeschichte des letzten Jahrtausends, 2007, S. 253).
„In einer anderen Weise
stehen die Tropenwälder in bemerkenswertem Zusammenhang mit Mitteleuropa.
Denn eine Form der Ausbeutung ist noch nicht aufgeführt worden: Tropenholznutzung.
Tatsächlich gibt es vier Hauptursachen der Tropenwaldvernichtung. (1)
Die erste und am besten bekannte ist der Eigenbedarf der Menschen in den betreffenden
Ländern. Roden, um Siedlungsland zu gewinnen, das war überall das primäre
Ziel der Umwandlung von Wäldern. Kleinflächig und ohne nennenswerte
Auswirkung auf die Größe der Tropenwälder und auf ihren Artenreichtum
wurden die Rodungen als Brandrodung schon seit Urzeiten der Besiedlung durch Menschen
betrieben. Die kleinflächige Nutzung im Wanderfeldbau hatte die Regenwaldbewohner
auch mit den Eigenschaften der Waldböden vertraut gemacht. Daher kommt es
nicht von ungefähr, daß bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts die amazonischen
Regenwälder fast unangetastet geblieben sind, obwohl Brasilien und Peru schon
erheblich länger als etwa Nordamerika von Europäern besiedelt und kultiviert
worden sind. (2) Die zweite Ursache war und ist die
Holznutzung. In den Tropenwäldern wachsen Edelhölzer mit sehr hartem,
gegen Termiten und Pilze widerstandsfähigem Holz. Die Holzhärte weist
übrigens darauf hin, daß diese Bäume ziemlich langsam wachsen
und nicht einfach unter tropischer Wärme und Feuchtigkeit in die Höhe
schießen. Sie gleichen mehr unseren Eichen, die sie allerdings an Holzhärte
noch weit übertreffen, als den schnellwüchsigen Kiefern oder gar den
Pappeln. Die mageren Böden der Regenwälder lassen kein stürmisches
Wachstum zu, außer sie sind jungen vulkanischen Ursprungs und enthalten
entsprechend reichlich mineralische Pflanzennährstoffe. Härte und Formstabilität
machen Tropenhölzer begehrt - auch in den außertropischen Gebieten
sowie für den Schiffsbau. Daher wurde in Zentralafrika weit mehr Tropenwald
gerodet, als die dortige Bevölkerung brauchte, um Bananen oder Cassava anzupflanzen.
Die tropischen Edelhölzer waren und sind das Ziel des Holzeinschlags. Weltfirmen
haben sich Konzessionen dazu gesichert. Auch in Indien, wo es zwar seit gut 100
Jahren Plantagen für die Erzeugung von Teakholz gibt, und in Südostasien
bildet die meist raubbauartige Gewinnung tropischer Edelhölzer den Hauptgrund
der Waldzerstörung. Dort hat jedoch eine andere Nutzungsform (3)
als dritter Grund in den vergangenen Jahrzehnten an Gewicht gewonnen: die Errichtung
von Ölpalmenpflanzungen. Palmöl wird von den Industrienationen für
chemische und pharmazeutische Zwecke gebraucht. (4)
Der vierte Grund schließlich ist die Umwandlung der Regenwälder in
Rinderweiden und Sojafelder. Die mittel- und südamerikanischen Tropenwälder
sind davon bei weitem am stärksten betroffen. Mit Ausnahme des ersten Grundes,
der sich ausschließlich auf die örtlichen, bedürftigen Bevölkerungen
bezieht, sind die Industrienationen an allen anderen massiv beteiligt. Sollten
sie nicht in ihren Wäldern genügend Ressourcen haben, um den Holzbedarf
zu decken?! Der Verbrauch ist aber so groß, daß das Holz aus den eigenen
Wäldern nicht annähernd ausreicht, obgleich es bis in die letzten Jahre
kaum noch zum Heizen verwendet wurde. Zunehmend werden in unserer Zeit Wälder
des Nordens, in Nordwestrußland und in Ostsibirien, für die Holzgewinnung
genutzt. Schutzorganisationen befürchten, daß nach den großen
Kahlschlägen in den Tropen nun noch größere in den borealen Wäldern
bevorstehen, weil diese pro Quadratkilometer weit weniger Bäume tragen als
die dicht bewachsenen Tropenwälder. Noch scheint
die Taiga unerschöpflich mit ihren 15 Millionen Quadratkilometern Nadelwald
( ).
Doch das Schicksal der Laubwälder im östlichen Drittel der USA mahnt
zur Vorsicht. Was dort mit damals noch technisch primitiven Mitteln in eineinhalb
Jahrhunderten vollzogen wurde, wäre gegenwärtig schon in einigen Jahrzehnten
möglich. Die Maschinen stehen dafür zur Verfügung - und die Abnehmer
auch. Denn Holz ist ein gefragter Naturstoff. Den nordischen (borealen) Nadelwäldern
wird zwar weniger Aufmerksamkeit zuteil, weil sie recht einförmig aussehen
und im Vergleich zu den Tropenwäldern auch nicht mit eindrucksvoller Biodiversität
aufwarten können, aber mit den in deutschen Forsten vorherrschenden Fichtenmonokulturen
sind sie keinesfalls gleichzusetzen. Auch die Taiga hat ihren spezifischen, unersetzbaren
Artenreichtum. Und sie bedeckt in riesigen Bereichen Sibiriens insbesondere Bodenschichten,
die weder das in ihnen gebundene Kohlendioxid noch das Methan in den Sümpfen
freigeben sollten. Denn die dortigen Massen an potentiell klimabeeinflussenden
Gasen sind so groß, daß sie alle Anstrengungen zum Klimaschutz bedeutungslos
werden ließen, so sie in den kommenden Jahrzehnten in die Atmosphäre
gelangten. Winterfrost und ununterbrochen kalte Klimaverhältnisse speicherten
Massen von organischem Material und entziehen so den Kohlenstoff, der darin gebunden
vorliegt, dem Gaskreislauf der Atmosphäre. In den Tropen wachsen die Bäume
fast überall auf Böden, die kaum Humus haben und die daher auch nichts
freisetzen können. In den Tropenwäldern ist es der Wald selbst, der
in die Berechnungen zu den Belastungsfolgen mit einbezogen werden muß, während
in den nordischen Nadelwäldern die Böden und die teilweise sehr tiefgründigen
Sümpfe dazukommen.“ (Josef H. Reichholf, Eine kurze Naturgeschichte
des letzten Jahrtausends, 2007, S. 254-256).
).
Doch das Schicksal der Laubwälder im östlichen Drittel der USA mahnt
zur Vorsicht. Was dort mit damals noch technisch primitiven Mitteln in eineinhalb
Jahrhunderten vollzogen wurde, wäre gegenwärtig schon in einigen Jahrzehnten
möglich. Die Maschinen stehen dafür zur Verfügung - und die Abnehmer
auch. Denn Holz ist ein gefragter Naturstoff. Den nordischen (borealen) Nadelwäldern
wird zwar weniger Aufmerksamkeit zuteil, weil sie recht einförmig aussehen
und im Vergleich zu den Tropenwäldern auch nicht mit eindrucksvoller Biodiversität
aufwarten können, aber mit den in deutschen Forsten vorherrschenden Fichtenmonokulturen
sind sie keinesfalls gleichzusetzen. Auch die Taiga hat ihren spezifischen, unersetzbaren
Artenreichtum. Und sie bedeckt in riesigen Bereichen Sibiriens insbesondere Bodenschichten,
die weder das in ihnen gebundene Kohlendioxid noch das Methan in den Sümpfen
freigeben sollten. Denn die dortigen Massen an potentiell klimabeeinflussenden
Gasen sind so groß, daß sie alle Anstrengungen zum Klimaschutz bedeutungslos
werden ließen, so sie in den kommenden Jahrzehnten in die Atmosphäre
gelangten. Winterfrost und ununterbrochen kalte Klimaverhältnisse speicherten
Massen von organischem Material und entziehen so den Kohlenstoff, der darin gebunden
vorliegt, dem Gaskreislauf der Atmosphäre. In den Tropen wachsen die Bäume
fast überall auf Böden, die kaum Humus haben und die daher auch nichts
freisetzen können. In den Tropenwäldern ist es der Wald selbst, der
in die Berechnungen zu den Belastungsfolgen mit einbezogen werden muß, während
in den nordischen Nadelwäldern die Böden und die teilweise sehr tiefgründigen
Sümpfe dazukommen.“ (Josef H. Reichholf, Eine kurze Naturgeschichte
des letzten Jahrtausends, 2007, S. 254-256).
„In einer Hinsicht ähneln die nordischen Wälder aber denen in den feuchten Tropen: Auf den weitaus größten Flächen ihres Vorkommens lassen sie sich kaum oder nur sehr schwer nachpflanzen. Bei den Tropenwäldern geht das Pflanzen besonders schlecht. Deshalb scheiterten auch die mit vielen Millionen Dollar ausgestatteten Plantagenprojekte in Brasilien, wie »Fordlandia« (vom Autokönig Henry Ford in den 1930er Jahren) und am Jarí mit den Gmelina- und Pinus(caribaea)-Pflanzungen des Milliardärs Ludwig. Die Tropenwaldverluste bleiben daher in der Flächenbilanz unserer Zeit Verluste, weil sie nicht, wie bei unseren Wäldern geschehen, in großem Umfang wieder aufgepflanzt werden können. Kaum besser gedeihen gepflanzte Forste allerdings auch in der borealen Waldzone. Sie lassen sich daher gleichfalls nicht mit dem vergleichen, was die europäische Forstwirtschaft in den mittleren Breiten während der zwei oder drei letzten Jahrhunderte erreichte. Unsere tatsächlich von deutschen Forstleuten begründete nachhaltige Forstwirtschaft konnte sich auf zwei besonders günstige Gegebenheiten stützen. Die eine liegt in den Böden, die viel besser für den Waldbau als die tropischen und borealen Böden geeignet sind. Der zweite Vorteil kam dadurch zustande, daß einige ziemlich robuste Baumarten vom so wechselvollen Klimaverlauf der vergangenen Jahrtausende ausgelesen worden waren, die sich durch eine vergleichsweise große Bandbreite an Toleranz gegenüber den Faktoren der Umwelt auszeichnen. Die in dieser Hinsicht beiden wichtigsten Baumarten wurden auch die »Brotbaumarten« der europäischen Forstwirtschaft, die Fichte (Picea abies) und die Waldkiefer (Pinus silvestris). Mit ihnen konnten im späten 18. und im 19. Jahrhundert regelrechte Monokulturen begründet werden, die sogar leicht in sogenannten Altersklassen aufwachsen und häufig aus einem einzigen Klon sind. Ein Klon bedeutet, daß es sich um die Samen eines Baumes handelt, so daß alle gepflanzten Jungbäume »Samengeschwister« sind und sich folglich genetisch wenig voneinander unterscheiden. Die große genetische Vielfalt der europäischen Baumarten, die, wie oben schon betont, den Härtetest starker Umweltveränderungen in den letzten Jahrtausenden hinter sich haben, ermöglichte es der Forstwirtschaft, besonders schnellwüchsige oder ertragreiche Sorten und Klone zu wählen. Unsere Wälder entsprechen daher weit mehr dem auf ähnliche Weise strenger Selektion des Saatgutes unterworfenen Getreide als einem Naturwald mit hoher innerer Vielfalt an Arten und genetischen Linien. Das macht sie anfällig.“ (Josef H. Reichholf, Eine kurze Naturgeschichte des letzten Jahrtausends, 2007, S. 256-257).„Europas Forste sind zwar produktiv, aber zu einheitlich, um den Angriffen gewachsen zu sein, die seitens der Insekten, Pilze oder auch von der Witterung auf sie einwirken. Besonders deutlich wurde dies um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert und in dessen ersten Jahrzehnten, als auf Hunderten oder Tausenden von Quadratkilometern Insektenkalamitäten die jungen Forste heimsuchten. Es gab Massenvermehrungen von Kiefernspinnern (Dendrolimus pini), Kiefernspannern (Bupalus piniarius) und sogar von den großen Kiefernschwärmern (Hyloicus pinastri), der auch Tannenpfeil genannt wurde. Riesige Schäden richteten Nonnenfalter (Lymantria monacha) und in den Eichenwäldern die Eichenwickler (Tortrix viridiana) an. Kiefern-, Fichten- und Eichenforste waren jeweils am stärksten betroffen. Die Schäden reichten von Beeinträchtigungen des Holzzuwachses bis hin zu so intensivem Kahlfraß, daß die Bestände abstarben und der Wald nachgepflanzt werden mußte. In Laubwald- und Obstbaugebieten kamen in den 1930er und ganz besonders stark wieder in den warmen Sommern Ende der 1940er/Anfang der 1950er Jahre Maikäferkalamitäten hinzu. Auslöser waren sowohl die braunen Waldmaikäfer (Melolontha hippocastani) als auch die gewöhnlichen Feldmaikäfer (Melolontha melolontha). Viele weitere Insektenarten und dazu diverse Pilze wie die schon für die Kartoffelkrise im 19. Jahrhundert verantwortliche Kartoffelfäule durch Phytophthora-Pilze traten massiv als Schädlinge auf. Borkenkäfer (Ipidae, insbesondere Ips typographus) sorgen bis in die Gegenwart für Schlagzeilen, weil sie rasch ganze Bestände befallen und die Bäume bis zu deren Absterben schädigen können. In Mitteleuropa entwickelte sich ein besonderer Zweig der Forstkunde, genannt Waldhygiene. Zum Schutz des Waldes wurden besonders die Großen Roten Waldameisen (Formica rufa) geschützt; Lockstoffallen (Pheromonfallen mit dem artspezifischen Sexuallockstoff) wurden entwickelt, um rechtzeitig Bestandszunahmen bei den Schädlingen zu bemerken. Ab einer Häufigkeitsschwelle wurde dann Gift angewandt. Es kam zum großen, aber recht kurzen Siegeszug von DDT (Dichlordiphenyltrichloräthan), das als umfassendes Insektizid wie ein Wundermittel zur Vernichtung der Malariamücken in den Tropen, der Obstbauschädlinge in den Gärten, der Läuse, Flöhe und Wanzen in den Häusern und eben auch der Schadinsekten in den Wäldern eingesetzt wurde. Schon in den 1950er Jahren traten die verheerenden Nebenwirkungen deutlich zutage.“ (Josef H. Reichholf, Eine kurze Naturgeschichte des letzten Jahrtausends, 2007, S. 257-259). Der Einsatz von DDT mußte (insbesondere wegen seiner gefährlichen Abbauprodukte, zu denen v.a. das Erstabbauprodukt DDD gehört) verboten werden; viele Tiere, auch nicht wenige Menschen, waren daran erkrankt, ein nicht geringer Teil der Vogeleier waren dadurch sogar so zerbrechlich geworden, daß die Eltern sie nicht ausbrüten konnten und ihre Nachwuchs sterben mußte.
|
 |
„»Es
ist deutlich geworden, daß eine Gesellschaft als Single-Gesellschaft, als
Gesellschaft atomistisch aufgelöster Individuen, nicht existieren kann. Sie
kann es demographisch ohnehin nicht (![]() ),
sie kann es mittelfristig finanziell nicht (
),
sie kann es mittelfristig finanziell nicht (![]()
![]() ),
sie kann es aber vor allem moralisch nicht.«“ (Paul Nolte, Generation
Reform - Jenseits der blockierten Republik, 2004, hier zitiert aus: Max Wingen,
Die Geburtenkrise ist überwindbar - Wider die Anreize zum Verzicht auf
Nachkommenschaft, 2004, S. 30).
),
sie kann es aber vor allem moralisch nicht.«“ (Paul Nolte, Generation
Reform - Jenseits der blockierten Republik, 2004, hier zitiert aus: Max Wingen,
Die Geburtenkrise ist überwindbar - Wider die Anreize zum Verzicht auf
Nachkommenschaft, 2004, S. 30).
 Weltraummüll
Weltraummüll

|
Der Weltraummüll umfaßt alle nach Raumfahrtunternehmungen im Weltall, vor allem aber in der Erdumlaufbahn verbleibenden inaktiven Erdsatelliten, Bauteile, Trümmer und Schrottgegenstände, die der Raumfahrt gefährlich werden können. Die durchschnittliche Differenzgeschwindigkeit zwischen Weltraummüll und Satellit beträgt ca. 10 km/s. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit besitzt bereits ein nur 1 cm großes Objekt eine kinetische Energie, die etwa der Energie einer Handgranate entspricht. Bereits Einschläge von Millimeter-Objekten können die Funktion eines Satelliten beeinträchtigen oder ihn sogar unbrauchbar machen. Die bemannten Module der „Internationalen Raumstation“ („ISS“) sind mit doppelwandigen Meteoritenschutzschilden ausgestattet und können aufgrund der durch den Einschlag in die erste Wand erzeugten Streuwirkung Einschlägen von Weltraummüll bis zu einem Zentimeter Durchmesser widerstehen. Bereits jetzt ist auf einigen Umlaufbahnen die durch Einschläge von Weltraummüll hervorgerufene Ausfallwahrscheinlichkeit operationeller Satelliten nicht mehr vernachlässigbar. Selbst Einschläge kleinerer Partikel bis in den Mikrometerbereich können empfindliche Nutzlasten beschädigen, Plasmaentladungen hervorrufen oder eine Bedrohung für das Leben von Astronauten bei Außenbordaktivitäten darstellen. Die bislang größte Kollision im All und gleichzeitig der erste Zusammenstoß zweier Satelliten überhaupt ereignete sich am 10. Februar 2009. Ein deaktivierter Kommunikationssatellit und ein Iridium-Satellit kollidierten in 789 km Höhe über Nordsibirien. Beide Satelliten wurden dabei zerstört. Die Kollision setzte eine erhebliche Menge weiteren Weltraummüll frei.
Eine besonders große Überfüllung mit Weltraummüll liegt im Höhenbereich zwischen 800 und 1500 km sowie in 36000 km Abstand, also im Bereich der geostationären Satelliten, vor. Weil dieser Bereich als Umlaufbahnen bevorzugt genutzt wird, wächst die Bedrohung für die kommerzielle und wissenschaftliche Raumfahrt. Konzepte für die Lösung dieses Problems scheitern momentan noch an den damit verbundenen Kosten. So wäre es denkbar, die Trümmer mit einem Laserstrahl zu verdampfen. Gelingt dies aber nicht vollständig, werden nur neue Teile in größerer Zahl erzeugt. Hinzu kommt der dafür benötigte hohe Energieverbrauch. Eine weitere Möglichkeit wäre, die Trümmer abzulenken und zum Verglühen zu bringen. Besser ist also eine vorsorgende Müllvermeidung.
lm Jahre 1993 fand in Darmstadt die 1. Europäische Weltraummüll-Konferenz mit 251 „Experten“ aus 17 Ländern statt.
 Wohnen ganz anders ist auch Gewohnheitssache
Wohnen ganz anders ist auch Gewohnheitssache

|
Im Universum gibt es Lebenszonen,
die habitable Zonen, bewohnbare Zonen oder auch Lebensgürtel ( )
genannt werden. Wir leben bzw. wohnen in 4 Lebenszonen (wenn man das Universum
selbst mitzählt!), denn wir leben ja (1)
in unserem Universum, (2)
in unserer Galaxie, (3)
in unserem Sternsystem, (4)
auf unserer Lebenskugel. Das Verlassen beginnt in umgekehrter Reihenfolge.
Zunächst werden wir unsere Erde, danach unser Sonnensystem, viel später
unsere Milchstraße und zuletzt unser Universum verlassen müssen, falls
uns das möglich ist. Abgefahrene Theoretiker sagen: Ja, das ist möglich
!
)
genannt werden. Wir leben bzw. wohnen in 4 Lebenszonen (wenn man das Universum
selbst mitzählt!), denn wir leben ja (1)
in unserem Universum, (2)
in unserer Galaxie, (3)
in unserem Sternsystem, (4)
auf unserer Lebenskugel. Das Verlassen beginnt in umgekehrter Reihenfolge.
Zunächst werden wir unsere Erde, danach unser Sonnensystem, viel später
unsere Milchstraße und zuletzt unser Universum verlassen müssen, falls
uns das möglich ist. Abgefahrene Theoretiker sagen: Ja, das ist möglich
!
Beinahe-Lichtgeschwindigkeit
Folgen
wir mal Einstein ( ):
„Bewegt sich ein Raumschiff mit nahezu Lichtgeschwindigkeit, so ist die Zeit,
wie sie für ein Besatzungsmitgleid an Bord des Schiffes vergeht, bedeutend
kürzer als die für die auf der Erde zurückgebliebenen Menschen.
Daß das durchaus mit rechten Dingen zugeht, konnte Einstein anhand seiner
»speziellen Relativitätstheorie« (
):
„Bewegt sich ein Raumschiff mit nahezu Lichtgeschwindigkeit, so ist die Zeit,
wie sie für ein Besatzungsmitgleid an Bord des Schiffes vergeht, bedeutend
kürzer als die für die auf der Erde zurückgebliebenen Menschen.
Daß das durchaus mit rechten Dingen zugeht, konnte Einstein anhand seiner
»speziellen Relativitätstheorie« ( )
zeigen. Demnach vergeht für einen Beobachter die Zeit in einem relativ zu
ihm bewegten Bezugssystem langsamer. Daß das tatsächlich stimmt, läßt
sich an den Satelliten des Global Position System (GPS) beobachten, deren
Zeitsignale gegenüber einer Uhr auf der Erde verspätet aufeinander folgen.
Bei großen Relativgeschwindigkeiten ist der Effekt drastischer. .... Drammatischer
wird die Sache, wenn der Astronaut fast mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs ist,
sagen wir: mit 99,9999995 Prozent der Lichtgeschwindigkeit. Wenn er nach zehnjähriger
Reise wieder auf der Erde landet, sind dort sag und schreibe 100 000 Jahre vergangen
! Vorausgesetzt, die Menschheit hat diese lange Zeit ohne große Veränderungen
überdauert, wird sich vermutlich niemand mehr an die 100 000 Jahre zuvor
gestartete Mission erinnern. In 100 000 Jahren kann die Technik gewaltige Fortschritte
gemacht haben; vielleicht sind neue Raumantriebe entwickelt worden, mit denen
die Menschheit die Erde mittlerweile verlassen hat, um eine bessere Heimat zu
finden. Doch auch wenn die Astronauten auf der Erde erwartet würden, so wären
sich Raumfahrer und Zurückgebliebene vermutlich ziemlich fremd. Andererseits
ermöglicht diese Diskrepanz in der Zeit aber auch Reisen zu entfernten Galaxien
in der den Menschen zugedachten Lebenszeit. Würde im Raumschiff die Zeit
gleich schnell vergehen wie auf der Erde, so wären die Astronauten schon
lange vor Erreichen ihres Ziels gestorben. So aber altern die Astronauten auf
einer Reise zur Andromeda-Galaxie nur um 28 Jahre - vorausgesetzt, sie fliegen
mit annähernder Lichtgeschwindigkeit.“ (Harald Lesch, Big Bang, zweiter
Akt, 2003, S. 369-371
)
zeigen. Demnach vergeht für einen Beobachter die Zeit in einem relativ zu
ihm bewegten Bezugssystem langsamer. Daß das tatsächlich stimmt, läßt
sich an den Satelliten des Global Position System (GPS) beobachten, deren
Zeitsignale gegenüber einer Uhr auf der Erde verspätet aufeinander folgen.
Bei großen Relativgeschwindigkeiten ist der Effekt drastischer. .... Drammatischer
wird die Sache, wenn der Astronaut fast mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs ist,
sagen wir: mit 99,9999995 Prozent der Lichtgeschwindigkeit. Wenn er nach zehnjähriger
Reise wieder auf der Erde landet, sind dort sag und schreibe 100 000 Jahre vergangen
! Vorausgesetzt, die Menschheit hat diese lange Zeit ohne große Veränderungen
überdauert, wird sich vermutlich niemand mehr an die 100 000 Jahre zuvor
gestartete Mission erinnern. In 100 000 Jahren kann die Technik gewaltige Fortschritte
gemacht haben; vielleicht sind neue Raumantriebe entwickelt worden, mit denen
die Menschheit die Erde mittlerweile verlassen hat, um eine bessere Heimat zu
finden. Doch auch wenn die Astronauten auf der Erde erwartet würden, so wären
sich Raumfahrer und Zurückgebliebene vermutlich ziemlich fremd. Andererseits
ermöglicht diese Diskrepanz in der Zeit aber auch Reisen zu entfernten Galaxien
in der den Menschen zugedachten Lebenszeit. Würde im Raumschiff die Zeit
gleich schnell vergehen wie auf der Erde, so wären die Astronauten schon
lange vor Erreichen ihres Ziels gestorben. So aber altern die Astronauten auf
einer Reise zur Andromeda-Galaxie nur um 28 Jahre - vorausgesetzt, sie fliegen
mit annähernder Lichtgeschwindigkeit.“ (Harald Lesch, Big Bang, zweiter
Akt, 2003, S. 369-371 ).
).
| - Sensationelles Erlebnis - |
 Zumindest theoretisch ist es möglich, über eine Einstein-Rosen-Brücke
(„Wurmloch“) raumzeitliche Abkürzungen zu nehmen, sogar von einem
in ein anderes Universum zu wechseln. Doch in anderen Universen herrschen wahrscheinlich
ja auch ganz andere Naturkräfte (
Zumindest theoretisch ist es möglich, über eine Einstein-Rosen-Brücke
(„Wurmloch“) raumzeitliche Abkürzungen zu nehmen, sogar von einem
in ein anderes Universum zu wechseln. Doch in anderen Universen herrschen wahrscheinlich
ja auch ganz andere Naturkräfte ( ),
ganz andere Verhältnisse. Oder können die etwa sogar auch in unserem
Universum herrschen?
),
ganz andere Verhältnisse. Oder können die etwa sogar auch in unserem
Universum herrschen?
Zum Beispiel: „was wäre, wenn die Massenverhältnisse
anders wären? Wenn beispielsweise das Elektron schon bei seiner Entstehung
nach dem Urknall geringfügig schwerer ausgefallen wäre, auf alle Fälle
aber schwerer als der Massenunterschied zwischen Neutron und Proton? Hätte
sich das Universum unverändert entwickeln können? Ganz im Gegenteil
! Dann wären nicht die Protonen, sondern die Neutronen die stabilen Teilchen
geworden, weil die Protonen sofort nach ihrer Entstehung die freien Elektronen
eingefangen und sich in Neutronen und Neutrinos verwandelt hätten. Aus diesen
Elementarteilchen lassen sich jedoch keine Atome, keine Elemente aufbauen. Entstanden
wäre eine elektrisch neutrale Welt ohne Ladungen, nur Neutronen und Neutrinos,
eine Welt ohne Planeten und natürlich auch ohne Leben. Das Universum wäre
sehr eintönig geblieben. Vielleicht wären Sterne entstanden, allerdings
nur Neutronensterne, kleine, einige zig Kilometer große, immens kompakte
Materiekugeln, von denen ein Teelöffel voll etwa einige hundert Millionen
Tonnen wiegt. Doch diese Sterne würden das Universum in völliger Dunkelheit
belassen, da sie nicht im sichtbaren Bereich des Spektrums leuchten. Daß
all das nicht geschehen ist, daß wir vielmehr in einem so vielfältig
strukturierten Universum leben, verdanken wir der Tatsache, daß in unserer
Welt die Elektronenmasse eben kleiner ist als die sowieso schon sehr geringe Massendifferenz
zwischen Neutron und Proton.“ (Harald Lesch, Big Bang, zweiter Akt,
2003, S. 388 ).
).
„Als
Nächstes wollen wir die Neutronen- und Protonenmasse ein wenig verändern.
Da der Massenunterschied zwischen diesen beiden Teilchen so klein ist, sind etwa
eine Sekunde nach dem Urknall rund sechsmal so viele Protonen vorhanden wie Neutronen,
so daß nach der Entstehung der ersten Elemente (primordiale Nukleosynthese)
die Materie in unserem Universum im wesentlichen zu 75 Prozent aus Wasserstoff
und zu 25 Prozent aus Helium besteht. Wäre das Neutron nur zehn Prozent schwerer,
so hätten sich fast nur Protonen, also Wasserstoffkerne gebildet. Wäre
dagegen das Neutron genauso schwer wie das Proton, so hätte es gleich viele
Neutronen und Protonen gegeben, und am Ende der primordialen Nukleosynthese wäre
lediglich Helium übrig geblieben. Sterne hätten sich aber in jedem Fall
bilden können. Bei nur aus Wasserstoff bestehenden Sternen wäre Helium
eben etwas später beim Wasserstoffbrennen entstanden. Dagegen hätte
bei reinen Heliumsternen das für das Leben so wichtige, lang andauernde Wasserstoffbrennen
gar nicht stattgefunden. Die Sterne hätten sich bedeutend schneller entwickelt,
und ihre dramatisch verkürzte Lebenszeit hätte nicht ausgereicht, um
das Leben während seiner langen Entwicklungsphase kontinuierlich mit Energie
zu versorgen. Und nicht zu vergessen: Es gäbe kein Wasser, denn ohne Protonen
können keine Wassermoleküle gebildet werden, und ohne Wasser ist Leben
nicht möglich. Somit verbleibt noch die Frage: Was wäre, wenn sich das
Massenverhältnis von Neutron und Proton genau umgekehrt verhielte, wenn das
Proton schwerer wäre als das Neutron? Alles hätte sich mit genau
entgegengesetztem Vorzeichen abgespielt. Eine Sekunde nach dem Urknall wären
sechsmal mehr Neutronen als Protonen vorhanden gewesen, und die primordiale Nukleosynthese
hätte zu einem Universum mit 25 Prozent Helium und 75 Prozent Neutronen geführt.
Im Prinzip hätte sich das Universum gar nicht so sehr verändert. An
die Stelle der Protonen wären Neutronen getreten und umgekehrt. Auch Sterne
hätten sich bilden können, in denen statt Wasserstoff eben Neutronen
zu Helium verbrannt würden. Der wesentliche Unterschied ist jedoch bei den
Prozeßzeiten der Kernfusionreaktionen zu suchen: Da die Neutronen elektrisch
neutral sind, fänden sie wesentlich schneller zusammen als die sich abstoßenden
Protonen. Wie bei reinen Heliumsternen wären auch diese Sterne bereits verlöscht,
noch ehe das Leben sich hätte aufrappeln können.“ Harald Lesch,
Big Bang, zweiter Akt, 2003, S. 388-389 ).
).
„Bisher
haben wir nur mit den Teilchenmassen gespielt. Wären die Auswirkungen ähnlich
dramatisch, wenn wir die Skalen der vier Grundkräfte verstellen?“
(Harald Lesch, Big Bang, zweiter Akt, 2003, S. 389-390 ).
).
„Beginnen
wir mit der schwächsten, der Gravitation. Diese Kraft besitzt eine unendliche
Reichweite, ihre Stärke nimmt jedoch mit dem Quadrat der Entfernung ab. Die
Gravitation bewirkt, daß sich zwei Körper gegenseitig stets anziehen,
und zwar mit einer Kraft, die proportional ist zum Produkt der beiden Massen.
Der Parameter, der die Gravitation bestimmt, ist die so genannte Gravitationskonstante
G, eine der Naturkonstanten. Daß die Gravitation die schwächste unter
den vier Grundkräften ist, liegt in erster Linie an der Kleinheit dieser
Konstanten. Sie ist dafür verantwortlich, daß die Sterne so riesengroß
sind. Unsere Sonne, ein absoluter Durchschnittsstern, hat eine Masse von rund
2 x 1030 Kilogramm und einen Durchmesser von gerundet 1,4
Millionen Kilometern. Da sie aufgrund dieser gewaltigen Masse über einen
entsprechend großen Vorrat an Wasserstoff verfügt, dauert das Wasserstoffbrennen
auch entsprechend lange. Sterne dieser Größenordnung verharren etwa
zehn Milliarden Jahre in der Phase des Wasserstoffbrennens. Wäre die Gravitationskonstante
größer, so würde bereits eine geringere Sternmasse ausreichen,
um den Druck und die Temperatur im Sterninneren auf die Werte ansteigen zu lassen,
die für das Wasserstoffbrennen nötig sind. Der Stern wäre folglich
kleiner und seine Lebensdauer entsprechend kürzer. Eine um den Faktor zehn
größere Gravitationskonstante würde die Lebensdauer unserer Sonne
auf etwa zehn Millionen Jahre verkürzen! .... Mit einem Muttergestirn, das
bereits nach etlichen zig Millionen Jahren das Wasserstoffbrennen einstellt, wäre
die Erde, vorausgesetzt sie hätte sich überhaupt entwickeln können,
mit Sicherheit ein toter Planet geworden. Natürlich können wir die Skala
für die Gravitationskraft auch in die andere Richtung drehen und G noch kleiner
machen, als es ohnehin schon ist. Zunächst würden die Sterne noch größer
und massereicher. Aber die Planeten würden vermutlich - je nachdem wie stark
die Masse des Sterns im Verhältnis zur Verringerung von G zunähme -
in immer geringerem Abstand um die Sterne kreisen und wären somit in einem
viel höheren Maße der Strahlung der Sterne ausgesetzt. Verringert man
G noch weiter, so kommt man schnell an einen Wendepunkt, an dem es im gesamten
Universum überhaupt keine Sterne, keine Planeten und keine Galaxien mehr
geben würde. Schuld daran ist die Ausdehnung des Universums. Ab einer gewissen
unteren Schwelle für G wäre die ausdünnende Wirkung der Expansion
auf die Materie dem Bestreben der Gravitation, die Materie zu Sternen und Galaxien
zusammenzuballen, überlegen, und das Universum bliebe auf ewig strukturlos.“
(Harald Lesch, Big Bang, zweiter Akt, 2003, S. 390-391 ).
).
„Im
Gegensatz zur Gravitation ist die Reichweite der schwachen Kernkraft außerordentlich
klein und hauptsächlich auf den Bereich des Atomkerns beschränkt. Diese
Kraft ist verantwortlich dafür, daß sich Quarks, die Bausteine der
Nukleonen, untereinander umwandeln können. Ein Beispiel ist der so genannte
b-Zerfall, wobei ein Neutron in ein Proton, ein Elektron
und ein Antineutrino zerfällt. Das Wesentliche ereignet sich dabei im Inneren
des Neutrons, wo sich eines der beiden Down-Quarks spontan in ein Up-Quark umwandelt.
Erinnern wir uns: Dieser Prozeß war verantwortlich dafür, daß
im frühen Universum das anfängliche Verhältnis von sechs Protonen
auf je ein Neutron binnen weniger Minuten auf sieben zu eins verschoben wurde.
Heute ist der Beta-Zerfall die Ursache für die Umwandlung der radioaktiven
Elemente in stabile Atome. Im Zusammenhang mit unseren Betrachtungen zur speziellen
Einstellung der Parameter unseres Universums ist jedoch der so genannte inverse
Beta-Zerfall von Bedeutung, bei dem die Vorgänge in umgekehrter Richtung
ablaufen: Aus einem Proton und einem Elektron entstehen ein Neutron und ein Neutrino.
Besonderen Einfluß hat diese Reaktion auf das Geschehen in massereichen
Sternen. Wie wir schon wissen, brechen diese Sterne am Ende ihres Lebens unter
ihrer eigenen Schwerkraft zusammen, wobei die Elektronen in die Protonen hineingepreßt
werden und der Stern in einer Supernova vom Typ II explodiert. Die dabei entstehenden
Neutronen formen im Zentrum einen Neutronenstern, und eine ungeheure Menge Neutrinos
rast durch den Sternrest nach außen. Insbesondere diese Neutrinos sind es,
die den Stern so stark aufheizen, daß er bei der Explosion nahezu seine
gesamte Masse mit all den erbrüteten schweren Elementen ins All hinausschleudert.
Bei einer veränderten schwachen Kernkraft gäbe es keine Supernovae und
somit auch keine schweren Elemente zum Aufbau von Planeten und den komplexen Molekülen,
aus denen sich die belebte Materie zusammensetzt. Die besondere Rolle der Neutrinos
beruht darauf, daß sie nur über die schwache Kernkraft mit Materie
wechselwirken. Diese Wechselwirkung ist so gering, daß eine etwa ein Lichtjahr
dicke Bleimauer nötig wäre, um sie zu stoppen. Aber genau das ist der
entscheidende Punkt bei einer Supernova-Explosion. Das Ausmaß der Neutrino-Wechselwirkung
mit Materie ist exakt so eingestellt, daß es in den engen Spielraum paßt,
in dem es zu einer Supernova-Explosion kommen kann. Bei einer etwas geringeren
Wechselwirkung gäben die Neutrinos bei ihrem Weg aus dem Stern zu wenig Energie
an die Sternhülle ab, so daß die Materie nicht entsprechend aufgeheizt
und der Stern folglich nicht explodieren würde. Wäre die Wechselwirkung
etwas stärker, so könnten die Neutrinos den Stern gar nicht verlassen,
sondern würden gleich bei ihrer Entstehung im Kern stecken bleiben. Dabei
würde zwar der Kern erhitzt, aber aufgrund der hohen Kerndichte käme
es zu keiner Explosion. Auch hier zeigt sich wieder, daß scheinbar geringfügige
Nuancen das Universum zu dem haben werden lassen, was es heute ist.“ (Harald
Lesch, Big Bang, zweiter Akt, 2003, S. 391-392 ).
).
„Analysieren
wir nun noch die starke Kernkraft. Wie bei der schwachen Kernkraft reicht ihr
Einfluß nicht über den Radius der Atomkerne hinaus. Wäre die Reichweite
auch nur um wenige Millimeter größer, so würde die gesamte Materie
im Universum zu riesigen Atomkernen zusammengezogen, die keine Ähnlichkeit
mehr hätten mit den Elementen, aus denen unsere Welt aufgebaut ist. Doch
das ist noch nicht alles! Daß es überhaupt Leben geben kann, beruht
unter anderem auch darauf, daß die starke Kernkraft nur auf die Nukleonen,
die Protonen und Neutronen, wirkt, nicht aber auf Elektronen. Das ist ein Glücksfall,
denn andernfalls würden die Elektronen mit hineingezogen in den Strudel der
Bildung riesiger Atomkerne, und alle Chemielaboratorien könnten von heute
auf morgen zusperren, weil es nämlich gar keine Chemie mehr gäbe. Die
chemische Wechselwirkung unter den Atomen, der Aufbau von Molekülen aus den
Elementen, beruht ja gerade auf dem gegenseitigen Austausch von Elektronen beziehungsweise
darauf, daß sich zwei an der Bindung beteiligte Atome ein oder mehrere Elektronen
teilen. Doch wenn es gar keine Elektronen mehr gäbe, wäre auch der »Leim«
verschwunden, der die Atome zu Molekülen zusammenfügt.“ (Harald
Lesch, Big Bang, zweiter Akt, 2003, S. 392-393 ).
).
„Die
elektromagnetische Kraft ist für das Aussehen des Universums von ähnlicher
Bedeutung. Wie auch bei der Gravitation ist deren Reichweite im Prinzip unendlich
groß. Da sie jedoch nur auf elektrisch geladene Teilchen wirkt, eine Ansammlung
gleich vieler positiver und negativer Ladungen nach außen aber elektrisch
neutral ist, ist ihre Wirkung in der alltäglichen Welt auf geringe Entfernungen
beschränkt. Im Gegensatz zur Gravitation, die alle Massen nur zusammenziehen
will, wirkt sie sowohl anziehend als auch abstoßend. Im Atom ist sie für
die Bindung der negativ geladenen Elektronen an den positiv geladenen Kern zuständig.
Im Atomkern scheint sich jedoch ihre Wirkung zu einem Problem auszuwachsen. Denn
mit Ausnahme des Wasserstoffs vereinigen alle Elemente mehrere positiv geladene
Protonen in ihren Kernen, die sich eigentlich abstoßen und zum Auseinanderfallen
des Atoms führen müßten. Doch die Kerne fallen nicht auseinander,
weil die starke Kernkraft dem entgegenwirkt und die Nukleonen zusammenhält.
Damit Atomkerne stabil bleiben, muß also die starke Kernkraft der elektromagnetischen
Kraft überlegen sein, aber wiederum nicht so sehr, daß die Kerne nicht
doch noch, beispielsweise bei der Kernspaltung, aufgebrochen werden können.
Wieder kommt es auf die richtige Balance der Kräfte an. Schon bei einer auf
die Hälfte verringerten starken Kernkraft würden nahezu alle Kerne instabil,
und bei einer Einschränkung auf ein Viertel der aktuellen Kraft fielen sie
spontan auseinander. Das Gleiche würde passieren, wenn die starke Kernkraft
unverändert bliebe, dafür aber die elektromagnetische Kraft ungefähr
um den Faktor 10 stärker wäre. Die elektromagnetische Kraft findet sich
aber auch auf einem Gebiet, wo man ihren Einfluß auf den ersten Blick nicht
vermuten würde: nämlich dem Licht. Licht ist eine elektromagnetische
Welle und transportiert somit Energie. Das trifft natürlich nicht nur für
den Bereich des sichtbaren Lichts zu, sondern ganz allgemein für das gesamte
elektromagnetische Spektrum. Dem Transport von Energie durch Strahlung begegnen
wir überall im Universum, beispielsweise bei den Kühlprozessen der interstellaren
Gas-, Staub- und Molekülwolken. Bevor dort Sterne entstehen können,
muß die Temperatur der Wolken erst auf einen Wert abfallen, bei dem der
Gasdruck in der Wolke der Gravitation nicht mehr die Waage halten kann. Ohne die
Strahlungskühlung gäbe es keine Sterne. Doch auch nach seiner Geburt
kann ein Stern auf den Mechanismus des Energietransports durch Strahlung nicht
verzichten, denn er muß die in seinem Inneren frei werdende Fusionsenergie
in Form von Licht wieder loswerden. Wenn das nicht möglich wäre, würde
es den Stern zerreißen, sobald die ersten Kernreaktionen stattfänden.
Auch bei Sternen, die ihre Energie nicht durch Strahlung, sondern wie in einem
Topf mit kochendem Wasser durch das Aufsteigen heißer Blasen, die so genannte
Konvektion, nach außen leiten, kann die Energie von der äußersten
Sternhülle, der Photosphäre, nur durch Strahlung abgegeben werden.“
(Harald Lesch, Big Bang, zweiter Akt, 2003, S. 393-394 ).
).
„Vielleicht hat sich
der eine oder andere schon einmal die Frage gestellt, warum das Universum so riesengroß
ist und so unvorstellbar alt: so groß, daß darin hunderte Milliarden
von Galaxien Platz haben und in jeder Galaxie wieder hunderte Milliarden von Sternen
vorkommen, und so alt, daß die Sterne genügend Zeit hatten, die für
das Leben unverzichtbaren Elemente auszubrüten. Im Wesentlichen sind zwei
Größen dafür verantwortlich: zum einen die Masse in unserem Universum
in Form von Sternen, Galaxien, Wolken und »Dunkler Materie« und zum
anderen die so genannte kosmologische Konstante. Bleiben wir zunächst bei
der Masse. Massen ziehen sich gegenseitig an, und zwar mit umso größerer
Kraft, je mehr davon vorhanden ist. Andererseits expandiert unser Universum seit
dem Urknall. Anziehung und Expansion zerren also beide in unterschiedlicher Richtung
an den Massen. Die Gravitationskraft arbeitet gegen eine Ausdehnung des Universums
beziehungsweise sie versucht, das bereits expandierte Universum wieder zusammenschnurren
zu lassen, während die allgemeine Expansion zu einer stetigen Vergrößerung
und zu einer Verringerung der Massendichte führt. Das Universum darf also
nicht zu viel Masse enthalten, so daß die Gravitation nicht die Oberhand
gewinnt und alles wieder in sich zusammenfällt. Zu wenig Masse hätte
die umgekehrte Folge: Die Materie würde so sehr auseinander gezerrt, daß
sie nicht mehr zu Sternen und Galaxien zusammenklumpen könnte. Und ein Universum
ohne Sterne ist ein Universum ohne Leben. In
diesem Konzert spielt die kosmologische Konstante eine nicht zu unterschätzende
Rolle. Als Einstein seine Gleichungen zur allgemeinen Relativitätstheorie
aufgestellt hatte, war ein Ergebnis seiner Berechnungen, daß das Universum
instabil sei. Für Einstein war dieser Gedanke unerträglich, da er sich
ein expandierendes oder sich zusammenziehendes Universum nicht vorstellen mochte.
Trickreich wie er war, führte er einen Parameter in seine Gleichungen ein
- die bereits erwähnte kosmologische Konstante - und machte ihren Wert gerade
so groß, daß die zusammenziehende Wirkung der Gravitation zu null
ausgeglichen wurde. Später konnte der Astronom Edwin Hubble jedoch zweifelsfrei
belegen, daß das Universum tatsächlich instabil ist und sich ausdehnt.
Als Folge dieser Erkenntnis sah sich Einstein genötigt, seinen Trick als
die größte Eselei seines Lebens zu bezeichnen. Heute hat dieser Parameter,
dem die Kosmologen den griechischen Buchstaben L (Lambda)
gegeben haben, wieder an Bedeutung für die weitere Entwicklung des Universums
gewonnen. L ist nämlich ein Maß für
die Energiedichte des Vakuums, also des leeren Raumes, dem jegliche Masse und
Strahlung fehlen, so daß nur noch die so genannte Vakuumenergie zurückbleibt.
Nach den Gesetzen der Quantenmechanik bilden sich aus diesem Energievorrat fortwährend
extrem kurzlebige Teilchen-Antiteilchen-Paare, die sich sofort wieder gegenseitig
vernichten und dabei die zu ihrer Entstehung vom Vakuum entliehene Energie erneut
an das Vakuum zurückgeben. Doch wie wirkt sich diese Vakuumenergie auf das
Universum aus? Mithilfe der Einsteinschen Gleichung »Energie ist gleich
Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat« könnte man der Vakuumenergie
eine Masse zuordnen und vermuten, daß diese einen Beitrag zur Gravitation
leistet, daß sie, je nach dem Vorzeichen von L,
entweder anziehend oder abstoßend auf die Masse der Sterne und Galaxien
wirkt. Doch das ist zu kurz gedacht. Der Kosmologe Gerhard Börner vom Max-Planck-lnstitut
für Astrophysik macht denn auch deutlich, daß L
verblüffenderweise keinerlei Wirkung auf gewöhnliche Massen hat. Vielmehr
ist L als ein Beitrag zur Krümmung der Raumzeit
zu verstehen, als eine Art innerer Druck im Kosmos, der das Universum und die
darin enthaltene Materie auseinander treibt. Dummerweise gibt es keine Möglichkeit,
den Wert von L direkt zu messen, man kann ihn nur auf
Umwegen abschätzen. Heraus kommt, daß L
außerordentlich klein ist. Die Theorie der Quantenmechanik fordert jedoch
für L einen Wert, der mindestens um 120 Größenordnungen
größer ist. Damit klar ist, was das bedeutet: 120 Größenordnungen
besagen nicht, daß das theoretische L lediglich
120-mal größer ist als der geschätzte Wert der Kosmologen, sondern
daß es mindestens um den gigantischen Faktor 10120 größer
sein sollte. Wenn das richtig wäre, dann müßte das Universum aufgrund
des starken inneren Drucks schon längst auseinander geflogen sein. Da das
jedoch nicht der Fall ist, kann das nur heißen, daß die quantenmechanische
Vakuumenergie sich nicht gravitativ im Universum auswirkt. - Neben anderen Ungereimtheiten
gehört insbesondere diese Diskrepanz zu den großen Rätseln, die
es zu lösen gilt, wenn wir das Universum verstehen wollen. Nun, wie groß
auch immer L letztlich sein mag - fest steht jedenfalls,
daß die zu unserem Universum vereinte Masse und L
so perfekt zusammenwirken, daß ein Kosmos mit Sternen entstehen konnte.
Glücklicherweise hat es dabei für seine Ausdehnung zur heutigen Größe
so lange gebraucht, daß den Sternen genügend Zeit blieb, sich in Ruhe
zu entwickeln und die Elemente zu produzieren, die das Leben für den Aufbau
seiner Strukturen benötigt.“ (Harald Lesch, Big Bang, zweiter Akt,
2003, S. 396-399 ).
).
„Fassen wir zusammen: Die eingangs geäußerte
Vermutung, es könnte für die Entstehung von Leben nicht ausreichen,
lediglich einen geeigneten Stern und einen passenden Planeten auszusuchen, hat
sich mehrfach bestätigt. Tatsächlich hängen die Entwicklung des
Universums und die Bildung von Sternen und Planeten davon ab, wie die Werte einer
Reihe fundamentaler Größen ausfallen und wie sie aufeinander abgestimmt
sind. Daß das Universum so geworden ist, wie es sich uns heute präsentiert,
verdanken wir der Tatsache, daß sowohl die einzelnen Teilchenparameter als
auch die Reichweite und die Stärke der Grundkräfte genau die Werte aufweisen,
die wir vorfinden. Hätten die Parameter von Beginn an anders ausgesehen,
so wäre daraus ein anderes Universum geworden, in den meisten Fällen
sogar ein Universum ganz ohne Atome. Geringfüge Änderungen dieser »Grundeinstellung«
würden unser heutiges Universum sofort zerstören beziehungsweise hätten
es gar nicht erst entstehen lassen. Es ist schon beeindruckend, wie im Wechselspiel
der Kräfte und Massen nur Nuancen darüber entschieden haben, daß
aus dem Urknall ein Universum hervorgegangen ist, in dem zumindest auf unserer
Erde eine Flora und Fauna und natürlich wir selbst entstehen konnten.“
(Harald Lesch, Big Bang, zweiter Akt, 2003, S. 399 ).
).
„Aber warum die Natur so ist, wie sie ist, warum
die Naturkonstanten und die Kräfte, welche die Entwicklungsprozesse steuern,
genau die Werte und Größen haben, die wir messen, und keine anderen,
ist nach wie vor eines der größten Rätsel der Physik. Wäre
es anders gekommen, so gäbe es niemanden, der sich darüber wundern und
rätseln könnte. Der Physiker Hans Joachim Blome ( )
vergleicht diese Situation mit der des Überlebenden beim russischen Roulette.
Seine Freude, in diesem Spiel gewonnen zu haben, wird gedämpft, sobald ihm
klar wird, daß er keine Gelegenheit gehabt hätte sich zu ärgern,
wenn er nicht gewonnen hätte - weil es ihn dann nämlich nicht mehr gäbe.
Eine allerdings ziemlich lapidare Antwort auf die Frage nach dem Warum könnte
lauten: Eben weil es in unserem Universum Leben gibt, können die Parameter
nur die Werte besitzen, welche die Existenz von Leben möglich machen. Diesen
logischen Schluß bezeichnet man auch als Anthropisches Prinzip. Anders formuliert
heißt das: Die beobachtbaren Werte der Naturkonstanten und die Anfangsbedingungen
unseres Universums erfüllen gerade die Bedingungen, welche für die Evolution
intelligenten Lebens notwendig sind. Geht man noch einen Schritt weiter und unterstellt,
daß der Entstehung des Universums die Absicht zugrunde liegt, ein bestimmtes
Ergebnis zu erzielen, so verschärft sich das Anthropische Prinzip zu der
Aussage, daß die Parameter so eingestellt sein mußten, damit
die Entwicklung von Leben möglich wurde. Hinter dieser auch als teleologisch
bezeichneten Auslegung des Anthropischen Prinzips steht das Wirken eines allem
übergeordneten Willens - eines Gottes, dessen Ziel von Anfang an die Erschaffung
von Leben war. Damit verlassen wir jedoch die Erklärungsebene der Physik
und müssen uns über die Prozesse, die zur Abstimmung der fundamentalen
Größen geführt haben, keine Gedanken mehr machen. Eine naturwissenschaftliche
Antwort auf die Frage, warum die Einstellungen so und nicht anders sind, muß
natürlich anders aussehen - aber um es nochmals zu betonen: Die Naturwissenschaften
haben keine Erklärung dafür! Wir können nur spekulieren. Es könnte
doch sein, daß alles auf einem puren Zufall beruht, daß aus der Menge
der im Rahmen der Naturgesetze zulässigen Werte zufällig die in unserem
Universum gültigen Bedingungen zum Zuge kamen. Doch wie wahrscheinlich ist
das? Der Quantenphysiker Lee Smolin rechnet uns vor, daß die Wahrscheinlichkeit,
bei einer dem Zufall überlassenen Einstellung der Parameter exakt die Wertekombination
zu finden, die unser Universum bestimmen, bei 10-229 liegt. Nach Roger
Penrose, Physiker an der Universität Oxford, ist der Satz der für unser
Universum grundlegenden Konstanten sogar nur einer von 101200 möglichen
Kombinationen. Mit anderen Worten: Daß auf zufällige Art und Weise
unser Universum zustande kam, erscheint - nahezu - ausgeschlossen. Spätestens
an diesem Punkt bleibt für manche Naturwissenschaftler nur Gott als Antwort.
Welche Antworten könnte es sonst noch geben? Nehmen wir einmal an, es existiert
eine eindeutige, selbstkonsistente Theorie für das gesamte Universum, ein
in jeder Hinsicht widerspruchsfreies mathematisches Modell. Das hieße: Aufgrund
mathematischer Gesetzmäßigkeiten konnte das Universum nur so und nicht
anders werden. Gäbe es eine derartige Theorie, so müßten wir sie
als Erklärung für unsere Welt hinnehmen. Aber was wäre das für
eine schreckliche Erklärung! Der Mensch müßte sich dann als das
Ergebnis einer mathematischen, seelenlosen Logik betrachten, und sein Dasein hätte
nicht mehr Sinn als eine mathematische Operation. Eine andere Erklärung beruht
auf der Möglichkeit multipler Universen, von ... deren Existenz Kosmologen
wie Andrei Linde felsenfest überzegt sind. Es widerspricht nicht den gängigen
Theorien über die Entstehung des Universums, daß sich aus dem Quantenschaum
des Vakuums fortwährend Blasen abschnüren, die zu neuen Universen expandieren.
Jedem dieser Universen liegen vermutlich andere Anfangsbedingungen zugrunde, und
in jedem bestimmen andere Gesetzmäßigkeiten und Naturkonstanten die
Entwicklungsgeschichte. Bei einer riesigen, vielleicht sogar unendlichen Anzahl
von Paralleluniversen muß zwangsläufig auch eines dabei sein, dessen
Feinabstimmung der Parameter genau der unseren entspricht. Da wir jedoch prinzipiell
nicht über den Rand unserer Blase hinaussehen können - und in Anbetracht
der andersartigen Gesetzmäßigkeiten -, werden wir über diese Universen
leider nie etwas in Erfahrung bringen. Vielleicht muß man analog zur biologischen
Evolution die spezielle Einstellung der Parameter unseres Universums als das Ergebnis
einer Evolution der Naturkonstanten betrachten: Aus einem Universum könnten
»Tochteruniversen« hervorgehen, wobei sich die Naturkonstanten leicht
verändert vererben. Universen mit »schlechten Genen«, zum Beispiel
einer zu großen Gravitationskonstante, würden schnell wieder kollabieren,
von der Bühne verschwinden und aussterben. Andere mit »besseren Genen«
würden sich weiter »fortpflanzen«. Wie in der Biologie würden
schließlich die Arten dominieren, welche die größte Anzahl von
Nachkommen hervorbringen. Doch wie soll man sich den Mechanismus der Fortpflanzung
bei einem Universum vorstellen? Der
Quantenphysiker Lee Smolin glaubt die Lösung in der Entstehung Schwarzer
Löcher am Ende des Lebens massereicher Sterne gefunden zu haben. Seiner Meinung
nach sind die Zustände in einem Schwarzen Loch nicht von denen des Urknalls
zu unterscheiden. In beiden Fällen handelt es sich um eine Singularität,
einen Zustand extremer Dichte, Temperatur und Energie. (
)
vergleicht diese Situation mit der des Überlebenden beim russischen Roulette.
Seine Freude, in diesem Spiel gewonnen zu haben, wird gedämpft, sobald ihm
klar wird, daß er keine Gelegenheit gehabt hätte sich zu ärgern,
wenn er nicht gewonnen hätte - weil es ihn dann nämlich nicht mehr gäbe.
Eine allerdings ziemlich lapidare Antwort auf die Frage nach dem Warum könnte
lauten: Eben weil es in unserem Universum Leben gibt, können die Parameter
nur die Werte besitzen, welche die Existenz von Leben möglich machen. Diesen
logischen Schluß bezeichnet man auch als Anthropisches Prinzip. Anders formuliert
heißt das: Die beobachtbaren Werte der Naturkonstanten und die Anfangsbedingungen
unseres Universums erfüllen gerade die Bedingungen, welche für die Evolution
intelligenten Lebens notwendig sind. Geht man noch einen Schritt weiter und unterstellt,
daß der Entstehung des Universums die Absicht zugrunde liegt, ein bestimmtes
Ergebnis zu erzielen, so verschärft sich das Anthropische Prinzip zu der
Aussage, daß die Parameter so eingestellt sein mußten, damit
die Entwicklung von Leben möglich wurde. Hinter dieser auch als teleologisch
bezeichneten Auslegung des Anthropischen Prinzips steht das Wirken eines allem
übergeordneten Willens - eines Gottes, dessen Ziel von Anfang an die Erschaffung
von Leben war. Damit verlassen wir jedoch die Erklärungsebene der Physik
und müssen uns über die Prozesse, die zur Abstimmung der fundamentalen
Größen geführt haben, keine Gedanken mehr machen. Eine naturwissenschaftliche
Antwort auf die Frage, warum die Einstellungen so und nicht anders sind, muß
natürlich anders aussehen - aber um es nochmals zu betonen: Die Naturwissenschaften
haben keine Erklärung dafür! Wir können nur spekulieren. Es könnte
doch sein, daß alles auf einem puren Zufall beruht, daß aus der Menge
der im Rahmen der Naturgesetze zulässigen Werte zufällig die in unserem
Universum gültigen Bedingungen zum Zuge kamen. Doch wie wahrscheinlich ist
das? Der Quantenphysiker Lee Smolin rechnet uns vor, daß die Wahrscheinlichkeit,
bei einer dem Zufall überlassenen Einstellung der Parameter exakt die Wertekombination
zu finden, die unser Universum bestimmen, bei 10-229 liegt. Nach Roger
Penrose, Physiker an der Universität Oxford, ist der Satz der für unser
Universum grundlegenden Konstanten sogar nur einer von 101200 möglichen
Kombinationen. Mit anderen Worten: Daß auf zufällige Art und Weise
unser Universum zustande kam, erscheint - nahezu - ausgeschlossen. Spätestens
an diesem Punkt bleibt für manche Naturwissenschaftler nur Gott als Antwort.
Welche Antworten könnte es sonst noch geben? Nehmen wir einmal an, es existiert
eine eindeutige, selbstkonsistente Theorie für das gesamte Universum, ein
in jeder Hinsicht widerspruchsfreies mathematisches Modell. Das hieße: Aufgrund
mathematischer Gesetzmäßigkeiten konnte das Universum nur so und nicht
anders werden. Gäbe es eine derartige Theorie, so müßten wir sie
als Erklärung für unsere Welt hinnehmen. Aber was wäre das für
eine schreckliche Erklärung! Der Mensch müßte sich dann als das
Ergebnis einer mathematischen, seelenlosen Logik betrachten, und sein Dasein hätte
nicht mehr Sinn als eine mathematische Operation. Eine andere Erklärung beruht
auf der Möglichkeit multipler Universen, von ... deren Existenz Kosmologen
wie Andrei Linde felsenfest überzegt sind. Es widerspricht nicht den gängigen
Theorien über die Entstehung des Universums, daß sich aus dem Quantenschaum
des Vakuums fortwährend Blasen abschnüren, die zu neuen Universen expandieren.
Jedem dieser Universen liegen vermutlich andere Anfangsbedingungen zugrunde, und
in jedem bestimmen andere Gesetzmäßigkeiten und Naturkonstanten die
Entwicklungsgeschichte. Bei einer riesigen, vielleicht sogar unendlichen Anzahl
von Paralleluniversen muß zwangsläufig auch eines dabei sein, dessen
Feinabstimmung der Parameter genau der unseren entspricht. Da wir jedoch prinzipiell
nicht über den Rand unserer Blase hinaussehen können - und in Anbetracht
der andersartigen Gesetzmäßigkeiten -, werden wir über diese Universen
leider nie etwas in Erfahrung bringen. Vielleicht muß man analog zur biologischen
Evolution die spezielle Einstellung der Parameter unseres Universums als das Ergebnis
einer Evolution der Naturkonstanten betrachten: Aus einem Universum könnten
»Tochteruniversen« hervorgehen, wobei sich die Naturkonstanten leicht
verändert vererben. Universen mit »schlechten Genen«, zum Beispiel
einer zu großen Gravitationskonstante, würden schnell wieder kollabieren,
von der Bühne verschwinden und aussterben. Andere mit »besseren Genen«
würden sich weiter »fortpflanzen«. Wie in der Biologie würden
schließlich die Arten dominieren, welche die größte Anzahl von
Nachkommen hervorbringen. Doch wie soll man sich den Mechanismus der Fortpflanzung
bei einem Universum vorstellen? Der
Quantenphysiker Lee Smolin glaubt die Lösung in der Entstehung Schwarzer
Löcher am Ende des Lebens massereicher Sterne gefunden zu haben. Seiner Meinung
nach sind die Zustände in einem Schwarzen Loch nicht von denen des Urknalls
zu unterscheiden. In beiden Fällen handelt es sich um eine Singularität,
einen Zustand extremer Dichte, Temperatur und Energie. ( ).
Könnte es aufgrund dieser Analogie nicht sein, daß hinter dem Ereignishorizont
eines Schwarzen Lochs ein neues Universum entsteht? Smolin hält es
für möglich. Wenn die Parameter des neuen Universums die Bildung von
Sternen begünstigen, wird es viele neue Schwarze Löcher hervorbringen
und sich weiter fortpflanzen, andernfalls aber aussterben. Anders ausgedrückt:
Nur Parameterkombinationen, die zahlreiche Sterne hervorbringen, werden auch zahlreiche
Nachkommen haben. Das entspricht dem Prinzip der Evolution und Auslese, wie wir
es aus der Biologie kennen, nur daß hier die Naturkonstanten die Rolle der
Gene übernehmen. Laut dieser Hypothese wäre eine Vielfalt von Universen
möglich, die unentwegt neue Sterne hervorbringt, welche sich weiterentwickeln,
zu Schwarzen Löchern kollabieren und wiederum neue Universen entstehen lassen.
Die Sternentwicklung wird zwar aufgrund der jeweiligen Parameterwerte jedesmal
etwas anders verlaufen, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis irgendwann einmal
ein Universum auftaucht, dessen Naturkonstanten die Bildung von Elementen, Molekülen
und schließlich auch die Existenz von Leben ermöglichen, ein Universum
mit »unseren« Naturkonstanten. Damit wäre die Entstehung von
Leben auch auf der kosmischen Ebene das zwangsläufige Ergebnis einer langen
natürlichen Entwicklungsreihe. Weder der Zufall noch eine übergeordnete
Macht hätten dem Leben auf die Beine geholfen, sondern dies wäre einer
Reihe physikalisch bedingter Ausleseprozesse zu verdanken gewesen. Und was ist
mit den vielen anderen Universen? Unter ihnen gäbe es sicher einige,
die unserem Universum sehr ähnlich wären, vielleicht auch mit einer
gleichartigen Form von Leben. Leider werden wir nie erfahren, wie das »Parallel-Leben«
aussieht, geschweige denn, was sich wirklich in einem Schwarzen Loch abspielt
oder beim Urknall geschah.“ (Harald Lesch, Big Bang, zweiter Akt,
2003, S. 399-403
).
Könnte es aufgrund dieser Analogie nicht sein, daß hinter dem Ereignishorizont
eines Schwarzen Lochs ein neues Universum entsteht? Smolin hält es
für möglich. Wenn die Parameter des neuen Universums die Bildung von
Sternen begünstigen, wird es viele neue Schwarze Löcher hervorbringen
und sich weiter fortpflanzen, andernfalls aber aussterben. Anders ausgedrückt:
Nur Parameterkombinationen, die zahlreiche Sterne hervorbringen, werden auch zahlreiche
Nachkommen haben. Das entspricht dem Prinzip der Evolution und Auslese, wie wir
es aus der Biologie kennen, nur daß hier die Naturkonstanten die Rolle der
Gene übernehmen. Laut dieser Hypothese wäre eine Vielfalt von Universen
möglich, die unentwegt neue Sterne hervorbringt, welche sich weiterentwickeln,
zu Schwarzen Löchern kollabieren und wiederum neue Universen entstehen lassen.
Die Sternentwicklung wird zwar aufgrund der jeweiligen Parameterwerte jedesmal
etwas anders verlaufen, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis irgendwann einmal
ein Universum auftaucht, dessen Naturkonstanten die Bildung von Elementen, Molekülen
und schließlich auch die Existenz von Leben ermöglichen, ein Universum
mit »unseren« Naturkonstanten. Damit wäre die Entstehung von
Leben auch auf der kosmischen Ebene das zwangsläufige Ergebnis einer langen
natürlichen Entwicklungsreihe. Weder der Zufall noch eine übergeordnete
Macht hätten dem Leben auf die Beine geholfen, sondern dies wäre einer
Reihe physikalisch bedingter Ausleseprozesse zu verdanken gewesen. Und was ist
mit den vielen anderen Universen? Unter ihnen gäbe es sicher einige,
die unserem Universum sehr ähnlich wären, vielleicht auch mit einer
gleichartigen Form von Leben. Leider werden wir nie erfahren, wie das »Parallel-Leben«
aussieht, geschweige denn, was sich wirklich in einem Schwarzen Loch abspielt
oder beim Urknall geschah.“ (Harald Lesch, Big Bang, zweiter Akt,
2003, S. 399-403 ).
).
„Es wird ein Zeitalter kommen, in dem es keine Sterne mehr
gibt, keine über Jahrmilliarden verläßlichen Energiequellen, die
das Leben erhalten. Nicht alle Sterne sterben zur gleichen Zeit. Unzählige
Sterne sind bereits erloschen, unzählige Sterne werden im Laufe von Milliarden
Jahren noch folgen. Unsere Sonne werleidet dieses Schicksal in etwa vier bis fünf
Milliarden Jahren. Sie wird sich zu einem Roten Riesen aufblähen und den
Planeten Merkur und sehr wahrscheinlich auch die Venus verschlingen - ein lokales
Ereignis, das zwar das Leben auf der Erde bedroht, das aber ohne spürbare
Auswirkung auf das übrige Universum sein wird. Doch wenn wir es bis dahin
nicht schaffen, auf einen anderen Planeten auszuweichen, vielleicht auf einen
Planeten in einem anderen Sonnensystem, dann ist das Schicksal der Spezies Mensch
besiegelt. Doch auch nach einem derartigen Exodus wären wir noch nicht auf
der sicheren Seite. Es wird der Moment kommen, da keine neuen Sterne mehr entstehen,
weil der Gasvorrat der Galaxien erschöpft ist. Dann werden alle Sterne unserer
Galaxis und auch die aller anderen Galaxien ausgebrannt sein, und es wird nirgendwo
mehr eine Supernova explodieren und frisches Material für neue Sterne in
das All schleudern. Von da an wird es finster sein im Universum, zumindest was
das für unsere Augen sichtbare Licht anbelangt, und es wird auf ewig finster
bleiben. Anstelle von Sternen wird es dann nur noch Braune Zwerge und Weiße
Zwerge geben, Neutronensterne und Schwarze Löcher. Die Kosmologen schätzen,
daß das in etwa 100 Billionen Jahren der Fall sein wird. Spätestens
dann wird es kein Leben mehr geben, zumindest keines der uns bekannten Art. Wir
wollen nicht behaupten, daß das Universum von da ab für alle Zeiten
tot sein wird; vielleicht schafft es das Leben ja, sich im Laufe der unvorstellbar
langen Zeit von 100 Billionen Jahren zu völlig anderen, für uns unvorstellbaren
Entwicklungsstufen aufzuschwingen, sich zu wandeln und anzupassen an die neuen
Verhältnisse. Aber die neuen Verhältnisse werden sehr, sehr fremdartig
sein, und dieses Leben wird keine Ähnlichkeit mehr haben mit jenem, wie wir
es kennen. Die Galaxien werden auch im Dunkeln noch für geraume Zeit als
zusammengehörige Systeme weiterbestehen, und längst ausgeglühte
Planeten werden um ausgebrannte Sternreste kreisen. Aber diese Bindungen halten
nicht ewig, Galaxien werden auf ihren Wegen durch das All einander nahekommen
und miteinander kollidieren. Unsere Milchstraße und die Andromeda-Galaxie
sind gegenwärtig schon auf Kollisionskurs. In etwa sechs Milliarden Jahren
könnte es zu einem Zusammenstoß kommen. Doch auch wenn das zu diesem
Zeitpunkt gerade noch einmal gut gehen sollte - langfristig ist eine Kollision
unvermeidbar, da die beiden Systeme durch die Gravitation aneinander gebunden
sind. Sie umkreisen sich, und weil dabei durch Reibung Energie verloren geht,
verschmelzen sie schließlich zu einem riesigen Haufen ungeordneter Sterne.
Für die Sonnensysteme einer Galaxie hat das einschneidende Konsequenzen.
Aufgrund der Schwerkraft aneinander vorbeiziehender Sterne werden die Planeten
allmählich aus ihren Bahnen geworfen und in das All geschleudert. Wissenschaftler
schätzen, daß in rund 100 Billiarden Jahren alle Planetensysteme zerfallen
sind. Schließlich bleiben auch die ausgebrannten Sonnen nicht von diesen
Auflösungserscheinungen verschont. Wie bei den Planeten kann bei der Begegnung
dreier Sterne der masseärmste aus der Galaxie katapultiert werden. Derartige
Drei-Körper-Begegnungen sind zwar relativ selten - sie kommen in einer Galaxie
etwa nur ein halbes Dutzend mal pro einer Milliarde Jahre vor -, aber im Universum
spielt Zeit keine Rolle, und auf lange Sicht ist das Ergebnis dramatisch. Irgendwann
zwischen einer Trillion (1018) und einer Quatrilliarde (1027)
Jahre werden die Galaxien etwa 99 Prozent ihrer Masse verloren und sich somit
praktisch aufgelöst haben. Der jeweils verbleibende Rest wird dann zu einem
einzigen supermassiven Schwarzen Loch kollabieren. Jetzt geht es ans Eingemachte,
an die eigentliche Substanz. Wenn die Theorien der Elementarteilchenphysiker stimmen,
dann löst sich auch die Materie insgesamt auf. Nach
etwa 1032 Jahren zerfallen nämlich selbst die Protonen, die elementaren
Bausteine der Materie, in Positronen und Photonen. Treffen die Positronen auf
ein Elektron, so vernichten sich die Teilchen gegenseitig, und es bleiben nur
noch Photonen übrig. Letztlich wird also die gesamte feste Materie, werden
alle Stern- und Planetenreste in Strahlung verwandelt sein. Dann gibt es im Universum
nur noch gigantische Schwarze Löcher, die in einem allumfassenden Meer von
Photonen und Neutrinos schwimmen. Sieht so die Ewigkeit aus? Sie ahnen es schon,
verehrte Leserinnen und Leser, die Kosmologen haben noch einen weiteren Trumpf
im Ärmel. Sie behaupten, daß auch die Schwarzen Löcher einmal
ihr Dasein beenden, indem sie verdampfen. In etwa 1080 Jahren sollen
diese Prozesse beginnen und erst in 10130 Jahren beendet sein. Dann
soll es wirklich nichts mehr geben außer Neutrinos und Photonen in Form
von extrem langwelliger elektromagnetischer Strahlung in einem extrem kalten,
leeren Universum.“ (Harald Lesch, Big Bang, zweiter Akt, 2003, S.
405-407 ).
).

|